Teil 2 – Commons verstehen und leben
Kapitel 4: Soziales Miteinander
Kapitelüberschriften
»Kultur ist gewöhnlich.« Das befand einmal der britische Soziologe Raymond Williams. Über Commoning lässt sich dasselbe behaupten. Es ist im Grunde furchtbar gewöhnlich. Commoning ist, was einfache Menschen in ihren jeweiligen Beziehungen und Umgebungen für sich selbst entscheiden und regeln, wenn sie miteinander gut auskommen und so viel Wohlstand wie möglich für alle schaffen wollen. Wenn Commoning als Lebensweise oder als eine Art von Kultur begriffen wird, dann gibt es uns das, was jegliche Kultur gibt: »Bedeutung sowohl in einem formalen als auch in einem zutiefst existenziellen Sinn«, wie der Kultursoziologe Pascal Gielen schreibt.[1] In modernen Gesellschaften wurde Commoning weitgehend vergessen. Wenn wir nun Commons-Ideen in ihrer elementaren Alltäglichkeit vorstellen, können wir sie als Plattform für gelebte Alternativen zum Kapitalismus interpretieren.
Wir beginnen die Erkundung der Triade mit dem Bereich des sozialen Lebens. Es ist das beherrschende Motiv aller Commons und drückt sich zugleich in den beiden anderen Sphären aus. Im Laufe von mehr als 15 Jahren haben wir Dutzende Commons besucht, mit Hunderten Menschen gesprochen und in der wissenschaftlichen Literatur zahlreiche Fallbeispiele durchgesehen. Beim gemeinsamen Nachdenken und Analysieren all dessen, begannen wir die Muster zu erkennen, die unseres Erachtens entscheidend für den Erhalt und die Entwicklung der Commons sind. Und die zudem einen Weg weisen, wie die »große Transformation« gelingen kann.
Ihre Kraft im Sinne der Commons entfalten diese Muster dann, wenn sie in der Praxis in ausreichender Dichte und Dauer angewendet werden, so die Schwelle bewusster Selbstorganisation erreichen und kohärente soziale Institutionen hervorbringen. Damit ist auch gesagt, dass Commoning nicht wie ein Ein-/Aus-Schalter funktioniert, wie etwas, das entweder existiert oder nicht; eher wie ein Dimmer, der die Intensität des Lichts behutsam regeln kann. So können die Muster des Commoning, die wir in den nächsten Kapiteln vorstellen, eine Praxis schwach oder stark prägen, je nachdem, was die Menschen tatsächlich tun. So wie wir zu jedem Zeitpunkt per Dimmer mehr oder weniger Leuchtkraft erzeugen können, haben wir auch jederzeit die Möglichkeit, das Commoning zu vertiefen, zu verflachen oder gar aufzugeben. Menschen sind sich mancher dieser Muster bewusst, anderer nicht. In den Traditionen und Gewohnheiten indigener Kulturen mag das, was wir als Commoning beschreiben, völlig normal und damit »unsichtbar« erscheinen. In westlichen Industriegesellschaften ist Commoning ebenfalls unsichtbar, aber aus einem anderen Grund: Es wurde von den Normen des Markt-Staats an den Rand gedrängt. Deswegen haben wir Commons in der ganzen Welt gewissermaßen »ausgegraben«: wir möchten die im Dunkeln liegenden, wenig diskutierten Prozesse des Commoning erhellen. Dafür brauchen wir eine Sprache, die uns erlaubt, gezielter zu benennen, was zu tun ist. Und wir brauchen Experimentierfreudigkeit, mit den betreffenden Mustern umzugehen. So können wir Commoning besser verstehen und zugleich ganz praktisch mitgestalten. Das ist ein Weg, der uns erlaubt, auch im Großen zu entwerfen, wie wir künftig gut leben, bedürfnisorientiert wirtschaften und weitgehend »jenseits von Markt und Staat« Probleme lösen können. Es ist eine Möglichkeit, die Verhältnisse zu verändern, sofern gleichzeitig kulturelle, organisatorisch-politische und wertschöpfende Aspekte angegangen werden – sofern also alle drei Sphären der Triade im Blick bleiben. Geschieht dies, transformieren wir Wirtschaft und Politik, unsere Institutionen, aber auch uns selbst. Uns selbst zu verändern bedeute, so J.K. Gibson-Graham, »unsere Welten zu verändern, und wenn die Beziehung wechselseitig ist, dann ist das Projekt, Geschichte zu machen, niemals fern, sondern immer unmittelbar hier, an den Grenzen unserer spürenden, denkenden, fühlenden, sich bewegenden Körper«.[2] Letztlich hat die Politik ihren Ursprung in unserer Subjektivität, sagen Gibson-Graham, und in »der sinnlichen Erfahrung, ein Körper zu sein«.
Pascal Gielen bezeichnet Kultur als »ein heimliches Labor für neue Lebensformen, ein allgegenwärtiger Inkubator, der kaum wahrgenommen wird, gerade weil er überall da ist«.[3] Commons sind ein solches Labor; eine Kultur, die schon immer überall existiert hat; sie wird nur derzeit nicht als kohärenter, wertschöpfender Prozess oder als eigenständige soziale Institution anerkannt. Heute schreiben sich die Kategorien der kapitalistischen Marktwirtschaft in unser Denken ein und uns dadurch mehr oder weniger vor, wie wir uns verhalten sollen, in was wir investieren, wie wir unsere Institutionen organisieren sollen usw. Dabei wird angenommen, dass Menschen im Grunde egoistische und materialistische Einzelwesen sind, die stets ihren eigenen Nutzen zu mehren trachten. Commoning beruht auf einem anderen Menschenbild. Kein Wunder, dass es uns ungewöhnlich erscheint.
Festzuhalten ist – noch bevor wir unsere Ausgrabungsfunde ausbreiten – wie Commoning seine katalytische Wirkung entfaltet: Je mehr man – wie gesagt – die Commons-Weltsicht verinnerlicht und je mehr man Commoning betreibt, desto mehr wird man Commoner. Mit der Zeit verändert das alles: Kultur, Politik und Wirtschaft.
Lassen Sie uns nun mit unserer Erkundung beginnen: mit dem Bereich des Sozialen, dem Miteinander, das Themen aufruft wie Zusammenarbeit, Beziehungsgestaltung oder die gemeinsame Nutzung von dem, was wir zum Leben und Menschsein brauchen.
Das soziale Leben des Commoning
Gemeinsame Absichten & Werte kultivieren
Rituale des Miteinanders etablieren
Ohne Zwänge beitragen
Gegenseitigkeit behutsam ausüben
Situiertem Wissen vertrauen
Naturverbundensein vertiefen
Konflikte beziehungswahrend bearbeiten
Eigene Governance reflektieren
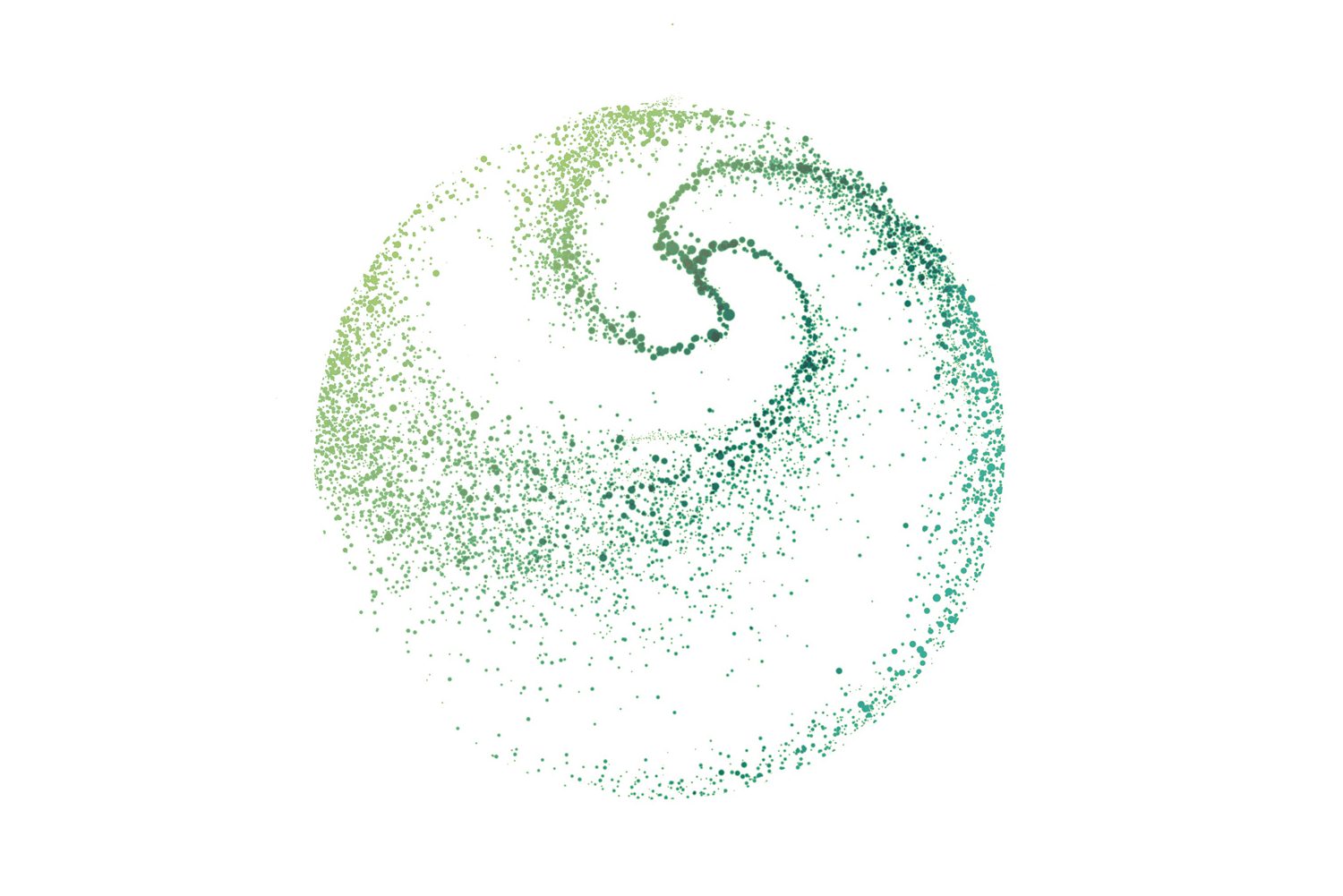
Gemeinsame Absichten und Werte sind das Herzblut eines jeden Commons. Ohne sie schwinden Zusammenhalt und Lebendigkeit. Doch können gemeinsame Absichten und Werte nicht vorausgesetzt werden. Sie entstehen, wenn Menschen aus eigenem Antrieb, aus Interesse und Leidenschaft heraus, etwas tun, was sie miteinander verbindet oder ihnen vergleichbare Erfahrungen ermöglicht. Ein Commons beginnt also nicht zwingend mit gemeinsamen Absichten und Werten. Sie müssen im Laufe der Zeit erarbeitet werden, im Ringen darum, vielfältige Perspektiven abzustimmen, wenn notwendig in Einklang zu bringen oder auch nebeneinander stehen zu lassen. (vgl. Sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten, Kapitel 5, S. 120) Das Gefühl, an etwas Gemeinsamen zu arbeiten und Werte zu teilen, stellt sich nicht ein, indem es formal auferlegt wird. Es nützt auch nichts, gemeinsame Absichten und Werte zu verkünden oder zu beschwören. Sie müssen immer wieder durch sinnstiftendes Commoning entstehen – und dann durch gemeinsame Reflexion, durch gelebte Traditionen, Feiern und alle möglichen Aktivitäten kultiviert werden. Sonst käme dies der Idee gleich, einen Baum zu pflanzen, ihn aber nicht zu gießen.
Gewiss, auch formale, organisatorische und infrastrukturelle Fragen spielen eine Rolle; aber wenn verschiedene Anliegen und Haltungen miteinander in Einklang zu bringen sind, gibt es für Commoning keinen Ersatz. Und das braucht Zeit. Eine gemeinsame Kultur kann nicht von einem Tag auf den anderen aufgebaut werden.
In der in Kapitel 1 erwähnten SoLaWi wird die Verpflichtung auf frische, lokal produzierte Bio-Lebensmittel auf verschiedene Weise kultiviert: durch Einladungen zu Hoffesten; durch die Möglichkeit, im vierzehntägigen Rhythmus für einige Stunden auf dem Hof mitzuarbeiten; durch Rezeptvorschläge für Gemüse der Saison; Einladungen zu Workshops, um alte Verarbeitungstechniken kennenzulernen und vieles mehr. Dabei ist die beste Art, Menschen zusammenzubringen: authentisch zu sein. Alle sollten idealerweise etwas beitragen können, was sie wirklich gerne tun. Die hilfreichste Frage dafür ist nicht: Was brauchen wir? Sie lautet: Was haben wir? Was ist mit dem möglich, was hier und jetzt verfügbar ist? Wendell Berry fasst dies poetisch zusammen:
Was wir brauchen ist hier
Gänse erscheinen hoch über uns,
ziehen vorbei, und der Himmel schließt sich. Unbekümmertheit,
wie in der Liebe oder dem Schlaf, hält
sie in ihrer Bahn, klar
im Vertrauen aus alter Zeit: was wir brauchen
ist hier. Und wir beten, nicht
für eine neue Erde oder einen neuen Himmel, sondern
im Herzen und im Auge still zu sein,
klar. Was wir brauchen ist hier.
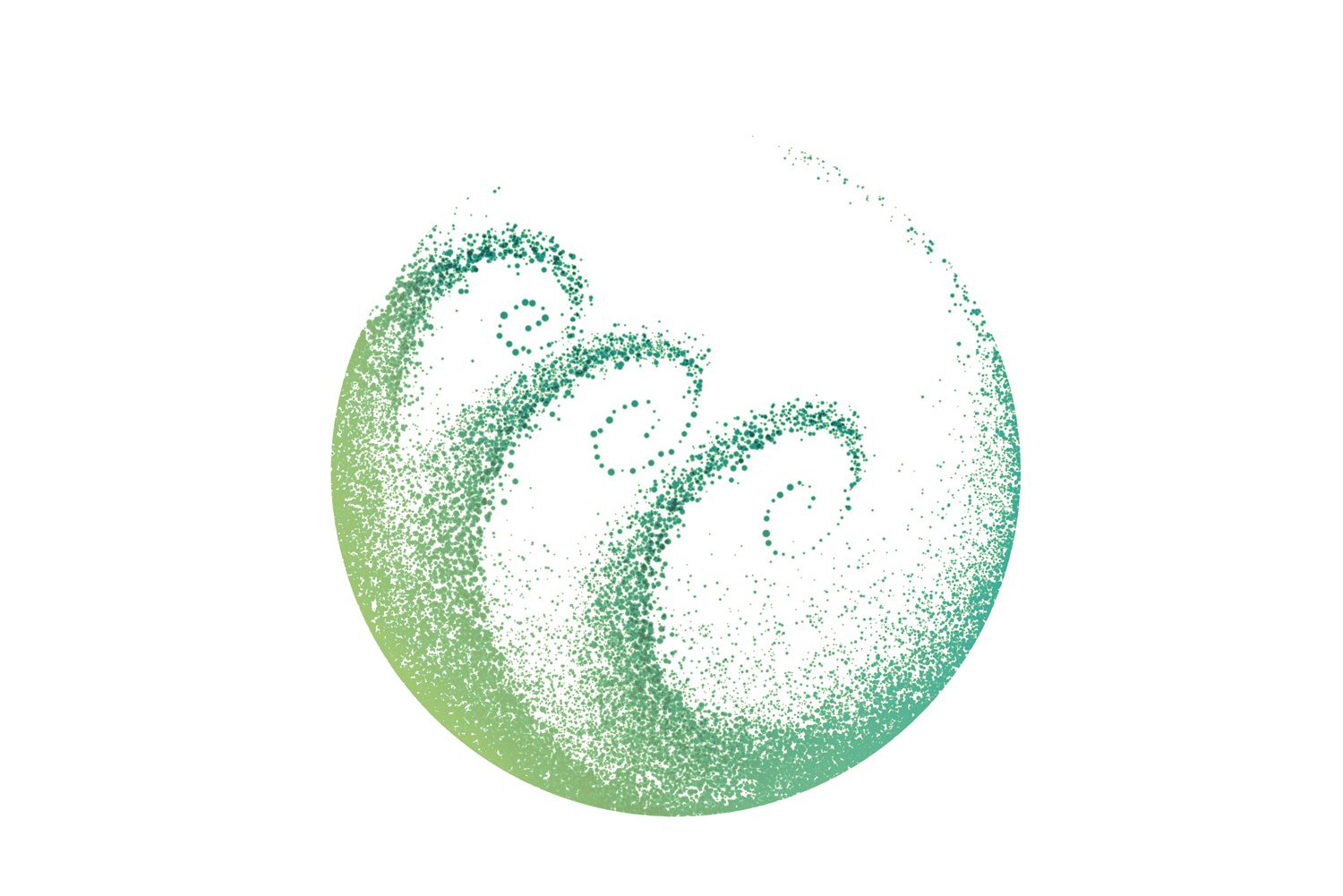
Eine der wichtigsten Formen, gemeinsame Absichten und Werte zu kultivieren und so eine identitätsstiftende Kultur des Commoning aufzubauen ist, Rituale des Miteinanders zu etablieren und zu pflegen: regelmäßig zusammenkommen, sich vertieft miteinander auszutauschen, gemeinsam kochen, Erfolge feiern, Fehlschläge offen und ehrlich analysieren. Solche Rituale können ganz einfach sein, wie das Blasmusikkonzert der Freiwilligen Feuerwehr. Oder sie sind sehr komplex und wirken etwas geheimnisvoll wie der Morgenstraich der Basler Fasnacht. Wichtig ist, auch Freude und Ausgelassenheit zu teilen. Das muss sein, sonst verliert der Prozess seine Anziehungskraft. Die vielen Bäuerinnen und Bauern in Lateinamerika, New Mexico und Colorado, die sich an den etwa 1.000 Jahre alten Acequia-Bewässerungssystemen beteiligen, haben im Laufe der Jahrhunderte gelernt, Rituale des Miteinanders zu etablieren. Selbstverständlich machen sich alle über ihre eigenen Wasserzuteilungen Gedanken, aber sie achten auch gemeinsam auf die ökologischen Grenzen der lokalen Wassernutzung, gehen Problemen zeitnah nach und kooperieren. So warten sie regelmäßig gemeinsam die Wassergräben – ganz so, wie es die Mitglieder hiesiger Fischereivereine in samstäglichen Freiwilligeneinsätzen mit »ihren« Flussufern tun. In den Software-Communities gibt es kreative Rituale, etwa Hackathons, bei denen die Programmiererinnen und Programmierer Lösungen für Softwareprobleme austüfteln und einen Jargon erfinden, den nur Eingeweihte verstehen. Die Quechua, die den Kartoffelpark in Peru leiten[4], sind durch ihre spirituellen Praktiken miteinander verbunden. Solche Praktiken helfen auch den indonesischen Subak-Reisbäuerinnen und -bauern zu entscheiden, wann sie ihre Saat ausbringen und ihre Felder bewässern, ohne zu viel Wasser zu verbrauchen. Rituale funktionieren dann am besten, wenn sie in den gewöhnlichen Alltag eingewoben sind und nicht wie ein Fremdkörper wirken. Enspiral, eine als Netzwerk strukturierte Gilde mit mehreren hundert Beteiligten, trifft nicht nur mit Hilfe der Online-Entscheidungssoftware Loomio Absprachen, sondern organisiert auch regelmäßige Klausurtagungen, um persönliche Begegnungen zu ermöglichen. In Ländern wie Griechenland, Italien, Frankreich und Finnland gab es bereits zahlreiche Festivals, die die Ethik, die Praxis und die Anliegen des Commoning in den Mittelpunkt stellten. Wie könnte man besser Rituale des Miteinanders etablieren – insbesondere unter Fremden – als mit einer Party oder einem Festival?[5] Manche Commoners scheinen aus allem ein Fest zu machen. Wenn in den offenen Werkstätten des Konglomerats[6] in Dresden mal wieder die gemeinsam genutzten Räume, Maschinen und Toiletten geputzt werden müssen, dann wird daraus ein Putzival. Der Begriff verwandelt die notwendige (Für-)Sorgearbeit in ein Event. Die Musik wird aufgedreht, alle putzen mit – und haben auch noch Spaß dabei.
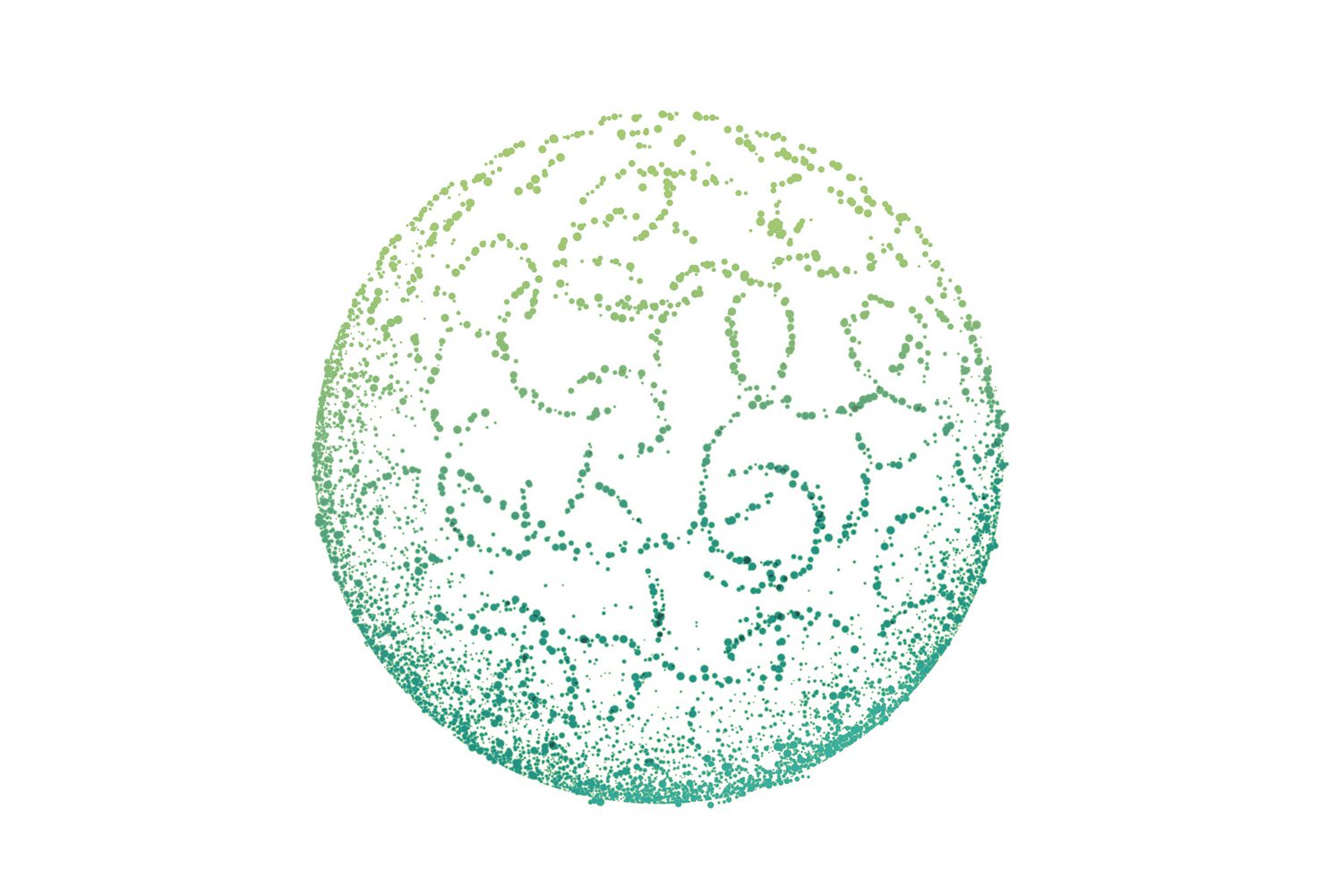
Ohne Zwänge beitragen bedeutet Geben ohne die Erwartung, etwas Gleichwertiges zurückzubekommen, jedenfalls nicht hier und jetzt. Es bedeutet auch, dass Menschen nicht den Zwang empfinden, eine direkte und unmittelbare Gegenleistung erbringen zu müssen, sobald sie etwas bekommen. Wo immer wir ohne Zwänge beitragen, erfährt das Prinzip »Leistung und Gegenleistung« einen Dämpfer. Das Potenzial des Aufteilens, Weitergebens und gemeinsamen Nutzens wird hingegen gestärkt. Das geschieht, wenn im Frühjahr in Gemeinschaftsgärten der erste Spatenstich gesetzt wird oder wenn Menschen redaktionelle Beiträge zur Wikipedia beisteuern, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten, noch nicht einmal ihre formale Namensnennung. Sie machen es einfach. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen: um etwas zu lernen, eine neue Fähigkeit auszuprobieren, Teil einer Gemeinschaft zu werden, Anerkennung zu bekommen, eine berufliche Qualifikation zu erwerben oder schlicht, um dabei zu sein. Natürlich gehört auch das Ernten, der Erhalt des eigenen Anteils oder der Wunsch, beim crowd-finanzierten staatsunabhängigen Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) als Gewinnerin ausgelost zu werden, zu den Motivationen.[7] Tatsache ist, Menschen tragen ohne Zwänge bei, wenn sie bei »Mein Grundeinkommen« mitmachen oder per Crowd funding Projekte finanzieren, wenn sie Wanderpfade instand halten oder Veranstaltungen in der Nachbarschaft organisieren. Das Geben selbst ist der Lohn.
Es ist wenig sinnvoll, präzise aufzulisten, wie in einem Commons ohne Zwänge beigetragen werden kann, denn so vieles ist situationsgebunden. Solange Beiträge nicht erzwungen werden, ist alles in Ordnung. Überlegungen, ob man quitt ist oder ob alles auf Gegenseitigkeit beruht, sollten nicht die Oberhand gewinnen, und doch ist es faszinierend festzustellen, dass ein ohne Zwänge geleisteter Beitrag häufig den Weg zurück zu den Gebenden findet, irgendwie, irgendwo. In seinem Klassiker Die Gabe. Wie Kreativität die Welt bereichert (1979, Deutsch: 2008) untersucht Lewis Hyde die spirituelle und emotionale Bedeutung des Gabentauschs in unterschiedlichen Kulturen, wie er in der Anthropologie und der Literatur beschrieben wird. Um den Unterschied zwischen dem »zirkulären« und dem gegenseitigen Geben zu erläutern, schreibt Hyde: »Wenn ich jemandem gebe, von dem ich nichts empfange (sondern nur von einem Dritten), ist es so, als käme das Geschenk aus dem Dunkel zurück. Ich muss gleichsam blind geben und werde dann auch eine Art blinde Dankbarkeit empfinden. ... Der Kreislauf entzieht es [das Geschenk] dem Einfluss des persönlichen Egoismus, und so bleibt jeder Geber Teil des Kollektivs, ist jede Gabe ein Akt des sozialen Vertrauens.«[8]
Natürlich geht es bei der Idee, ohne Zwänge beizutragen, nicht darum, bedingungslos und unaufhörlich zu geben. Das Gegebene zirkuliert auch nicht zwangsläufig im Kreis. Wenn es aber das Ziel ist, zu einem robusten Commons beizutragen, dann muss sichergestellt sein, dass Beiträge freiwillig (oder gemeinsam beschlossen) sind – und nicht eine Reaktion auf äußeren Druck oder Sanktionen. Ohne Zwanglos geleistete Beiträge, wird ein Commons auf Dauer nicht überleben. Die spezifischen Möglichkeiten, den gemeinsamen Pool zu füllen – wo? wann? wie? wie viel? – hängen vor allem davon ab, was Menschen wirklich geben können. Das wiederum ist ein Spiegel ihrer sozioökonomischen Lage, ihres kulturellen Kontexts, gewohnheitsmäßiger Regeln oder der Intensität ihres Engagements. Es ist aber auch Ausdruck ihrer Einschätzung laufender Prozesse, des Vertrauens in Entscheidungsverfahren oder der Zufriedenheit mit Beteiligungsformen etc. Selbstverständlich geben und schenken Menschen auch einfach aus Wohlwollen, Freude, innerer Überzeugung, oder weil sie eine bestimmte Angelegenheit unterstützen möchten. Warum auch immer sie Ohne Zwänge beitragen, es stabilisiert ein Commons, denn es stärkt eine Ethik des gemeinsamen Nutzens und (Auf-)Teilens sowie die Idee der Freiwilligkeit. Im Einzelfall kann es hilfreich sein, genau zu dokumentieren, wer wem was gibt. Gerade in größeren und weniger persönlichen Zusammenhängen mag dies funktional erscheinen. Erforderlich ist es im Prinzip aber nicht. Die Praxis, Beiträge und Ansprüche genau zu fixieren und gegeneinander aufzurechnen, kann gerade das Besondere eines Commons außer Kraft setzen: nämlich ein Raum zu sein, in dem Geld und andere Beitragsleistungen eben nicht über alles regieren.

Obgleich viele Menschen ohne Zwänge beitragen, sind Commons kein Märchenland, in dem sich Freiwillige aufopfern, die man heute gerne als »Gutmenschen« verunglimpft. Es wird auch gehandelt. Es gibt also einen Tausch, der auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit fußt (siehe Kapitel 6). Die Gegenseitigkeit in Commons ist jedoch ihrem Wesen nach anders als beim Tauschhandel auf den Märkten. Letzterer beruht auf der Idee, dass Einzelne möglichst viel für sich herausholen wollen, wenn sie Waren desselben Geldwerts (Preis) austauschen. Worauf es bei Commons letztlich ankommt, ist ein Gefühl der Fairness. Das verlangt nicht notwendigerweise, allen genau gleiche Anteile zukommen zu lassen und auch keinen »Äquivalententausch in Geldwerten«, wohl aber sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse aufgenommen wurden und auch strukturell benachteiligte Personen in würdevoller Weise das bekommen, was sie benötigen. Ein selbstbewusstes, gütiges Commons-Umfeld ist also eines, in dem die Beteiligten gut damit leben können, wenn sie im Laufe der Zeit in den Genuss eines ungefähr ausgeglichenen (aber nicht absolut gleichen) Verhältnisses von Geben und Nehmen kommen. Die Entscheidung, »nicht genau auszurechnen«, wer wem etwas schuldet, ist die Praxis der behutsam ausgeübten Gegenseitigkeit. Sie ist nicht selten eine Angelegenheit der sozialen Weisheit und Toleranz. Auf strikte, direkte Gegenseitigkeit zu bestehen und damit immer wieder eine Welt zu erzeugen, in der Menschen vor allem als Schuldner oder Gläubigerinnen gesehen werden, kann Neid, soziale Spannungen und polarisierende Eifersucht schüren. Wenn aber Trittbrettfahrerinnen und Trittbrettfahrern erlaubt wird, sich um ihren fairen Beitrag zum Gemeinsamen zu drücken, führt dies ebenfalls zu Ressentiments und zu abnehmender Toleranz. In den Worten von Elinor Ostrom: »Keiner möchte der ›Dumme‹ sein und zu einem Versprechen stehen, das sonst keiner einhält.«[9] In einem Commons muss also sichergestellt sein, dass Geben und Nehmen im Laufe der Zeit in einem grob ausgewogenen Verhältnis stehen, ohne auf eine zu überprüfende strikte Gegenseitigkeit zu bestehen und ohne Beiträge zu erzwingen (mehr dazu in Kapitel 6).
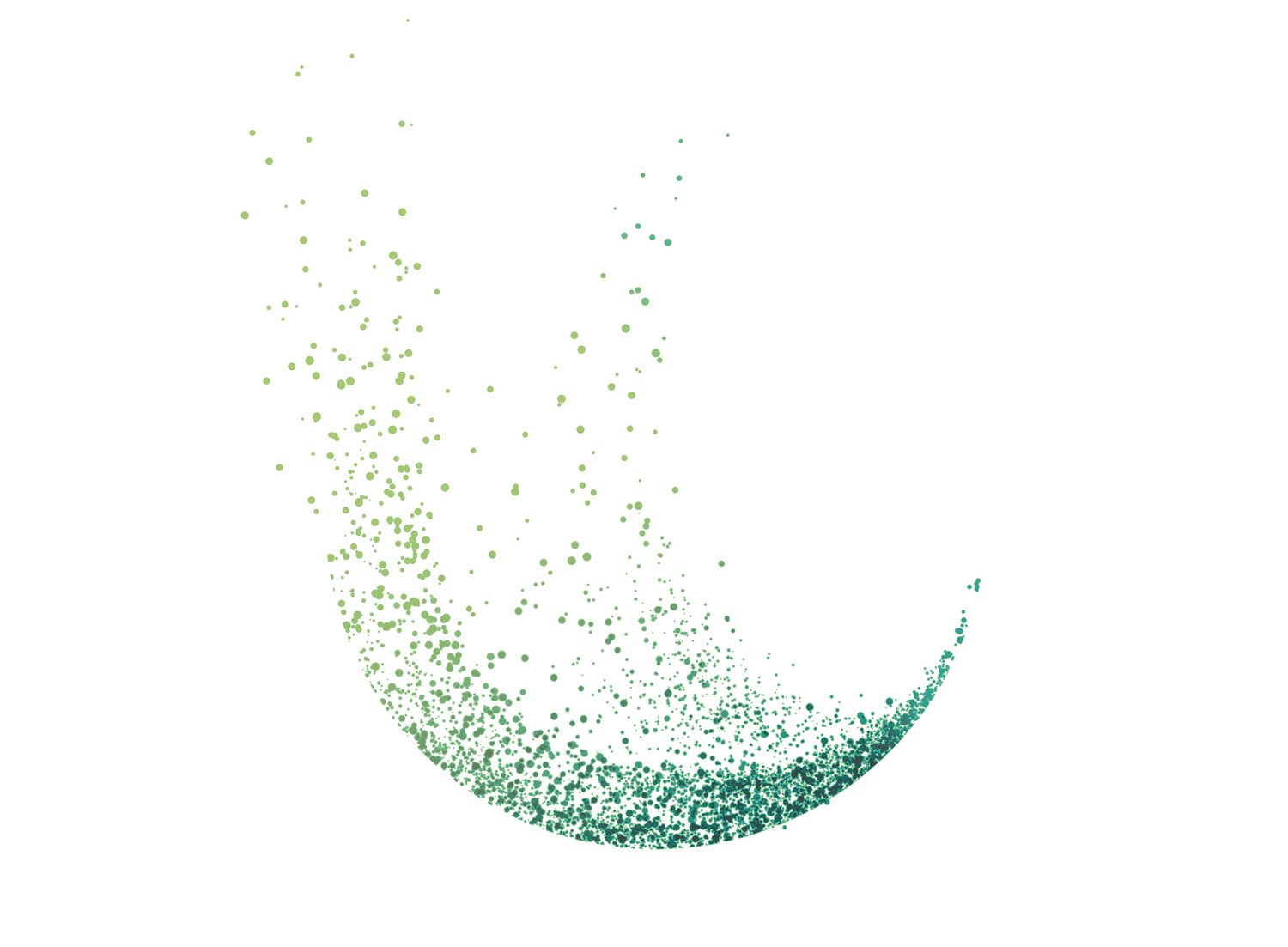
Der Befund, »daß wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen,«, wurde von Michael Polanyi in seinen wissenstheoretischen Büchern formuliert.[10] Das bedeutet: ein großer Teil unseres Wissens bleibt unausgesprochen, ja unaussprechbar, denn er ist in unsere Körper eingeschrieben. Verkörpertes Wissen ist unserer Vernunft und der Sprache nicht unmittelbar zugänglich und doch für unser Tun unerlässlich. Alle, die Fahrrad fahren, Klavier spielen oder schwimmen können, »wissen« das. Sie können nicht erklären was genau sie tun, aber sie tun es. Mitunter brillant. Unser Körper »weiß« anderes als unser Bewusstsein. Aus diesem Grund haben wir oft ein sehr feines intuitives Wissen über bestimmte Vorgänge und Prozesse – fast wie ein siebter Sinn. Dazu kommt, dass jedes – auch das wissenschaftliche – Wissen einen Ort hat. Das ist sowohl räumlich als auch sozial zu verstehen. Es bedeutet, dass das, was wir wissen, vom Kontext geprägt ist, in dem wir uns bewegen. Diese Prägung begrenzt grundsätzlich, was wir wissen. Zugleich erscheint das Wissen geschärft, vollgesogen mit spezifischen Informationen, die von einem anderen Ort oder Standpunkt des Forschenden aus nicht zugänglich wären. Die feministische Philosophin und Biologin Donna Haraway hat für dieses Phänomen den Begriff »Situiertes Wissen« (engl. Situated Knowledge) geprägt.[11] Er macht deutlich, warum es so wichtig ist, verschiedene Perspektiven und Wissensarten miteinander zu verknüpfen, so dass nie eine Wissensart dominieren kann. So ist die Idee des situierten Wissens immer auch eine kritische Überprüfung des herrschenden Wissens.[12] In unserem Kontext sind die Wissenden vor allem die Commoners selbst. Situiertes Wissen beschreibt zum Beispiel eine besondere Vertrautheit mit Landschaften und Umgebungen, in denen wir leben und arbeiten. Dieses sehr spezifische Wissen fließt in die Bewertung von Situationen und in unser Handeln ein. Man kann daher durchaus sagen, dass Commoning mit verkörpertem und situiertem Wissen und Wahrnehmen beginnt. Es erlaubt uns, Commons besser zu verstehen, als wenn wir nur »rationale«, verhaltensökonomische Ansätze zum »Management von Menschen und Ressourcen« verfolgen. Unser Innenleben wird angesprochen und ernst genommen. Andere Arten des Wissens – andere Wissenssysteme, aber auch Intuitionen und Gefühle – bekommen Raum. Genau wie das Zusammenspiel von Ich, Du, Wir uns unser Menschsein anders »begreifen« lässt, trägt auch unser physischer Körper zum Bewusstsein, zur Bewusstwerdung bei. Eine sprachliche Beschreibung allein würde diesem Erleben nicht gerecht. Im verkörperten und im situierten Wissen drückt sich das Leben selbst aus. Ein Beispiel dafür liefert der Anthropologe James Suzman. Er beschreibt, wie er an der Bedeutung von n!ow herumrätselte. Dieses Wort wird von den Ju/‘hoansi-Buschleuten im südlichen Afrika verwendet. Es scheint sich auf eine fundamentale Eigenschaft von Mensch und Vieh zu beziehen, die sich immer dann im Wetter manifestiert, wenn solche Tiere getötet werden oder wenn ein Mensch geboren wird oder stirbt. Es gelang Suzman nie, die durch n!ow ausgedrückte Idee vollkommen zu begreifen. Also kam er zu dem Schluss, dass manches schlichtweg nicht durch Sprache ausgedrückt, geschweige denn in eine andere Sprache übersetzt werden kann. »Um n!ow zu kennen und zu verstehen, muss man aus diesem Land hervorgegangen, von seinen jahreszeitlichen Rhythmen geformt sein, und man muss die Bindungen, die zwischen Jägern und ihrer Beute entstanden sind, erlebt haben.« [13] In ihrem Buch Tending the Wild (etwa: Die Wildnis hegen) zeigt M. Kat Anderson, dass die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner in dem Gebiet, das wir heute als Kalifornien kennen, über eine erstaunlich subtile Kenntnis ihrer Ökosysteme oder bestimmter Pflanzen- und Tierarten verfügten: »Mehrere wichtige Dinge wurden mir klar, als ich mit Ältesten unterwegs war, um Pflanzen zu sammeln. Das erste war, dass man Respekt für die Natur entwickelt, indem man sie umsichtig nutzt. Indem man eine Pflanze nutzt, mit ihrem Standort interagiert und das eigene Wohlergehen mit der Existenz der Pflanze verknüpft, kann man eine intime Beziehung mit ihr auf bauen und sie verstehen. Dasselbe gilt für Tiere.«[14]
Nicht nur die Ju/‘hoansi und andere indigene Völker sind gegenüber Veränderungen in der Natur und in unseren Beziehungen hochsensibel. Wir alle können diese Sensibilität kultivieren. Über situiertes und verkörpertes Wissen, über Instinkt, verfügen wir ohnehin. Wie wichtig es ist, lässt sich an Bergsteigerinnen und Bergsteigern erkennen, die die Stabilität von Schneebrücken prüfen, an Fußballspielern, die ahnen, wohin und wie schnell der Ball fliegt, oder an Politikerinnen, die die öffentliche Stimmung intuitiv erfassen und beeinflussen.
Für Commons sind spezifische Zugänge und Kenntnisse für die sachgerechte Bewirtschaftung von Naturreichtümern bedeutsam. Wenn Menschen auf bewährte Erkenntnisse und Weisheiten zurückgreifen, ist das der Robustheit von Commons zuträglich. Situiertes und verkörpertes Wissen ist also nicht einfach »Wissen«. Es folgt aus dem Tun und der Erfahrung, welche oft aus einem tieferen Verbundensein mit der Natur und aus »affektiver Arbeit« rührt. Die Macht des Rationalismus‹, der einer faktenbasierten Bürokratie Vorschub leistet, ist überwältigend. Dennoch hindert uns nichts daran, verkörpertes und situiertes Wissen zu würdigen und zu nutzen. Es ist ohnehin überall präsent. Es ist in uns, selbst wenn wir es nicht ohne weiteres erkennen und nicht ermutigt werden, diesem W/wissen zu vertrauen. Der Politikwissenschaftler Frank Fischer hat einmal die Gewohnheit von Fachleuten dokumentiert, »lokales Wissen, das helfen kann, technische Fakten und soziale Werte miteinander in Beziehung zu setzen, zu ignorieren«.[15] In Bürokratien und den großen Institutionen, die die Welt des Wissens prägen, ist das durchaus üblich.
Es gibt ein aktives Bemühen darum, dieser Ignoranz etwas entgegenzusetzen, indem sie sich auf die Kraft situierten und verkörperten Wissens beziehen: Permakultur-Gestalterinnen und -Gestalter betonen beispielsweise immer wieder, wie notwendig es ist, darauf zu achten, dass man »beobachtet und interagiert« sowie »Veränderungen kreativ nutzt und auf sie reagiert«.[16] Menschen in der Transition-Town-Bewegung sind stolz darauf, eine postfossile Welt mit »Kopf, Herz und Hand« zu schaffen.
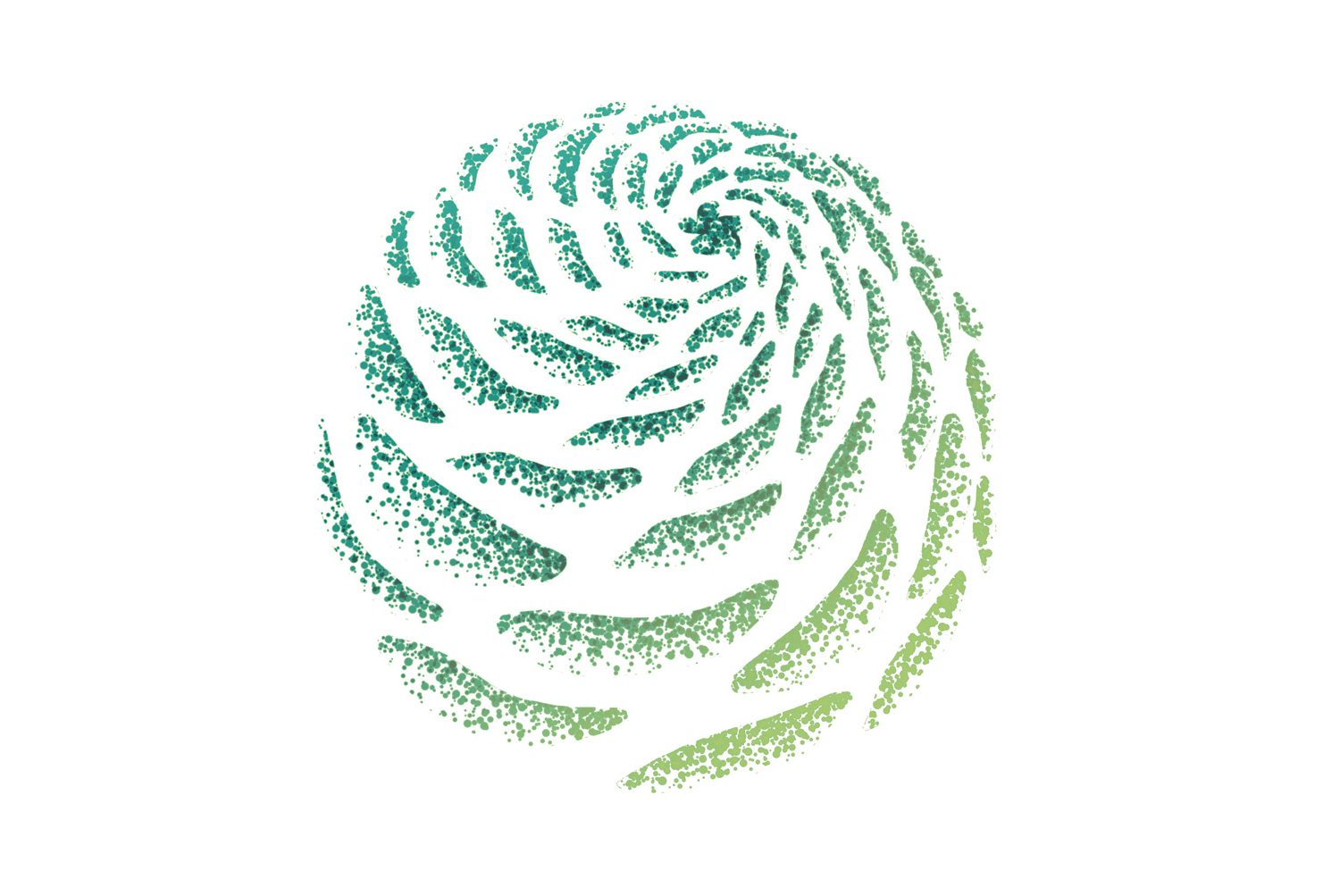
Zur Anziehungskraft vieler Commons gehört, dass wir uns in ihrem Kontext enger mit der Natur und mit anderen verbinden können. Wenn Naturvermögen wie Wasser, Ackerland, Wälder, Fischgründe, Wildbestände im Mittelpunkt eines Commons stehen, erkennen die Beteiligten schnell, dass es natürliche Grenzen gibt. Menschen bekommen praktische Mittel in die Hand, damit umzugehen. Wer mit Agroökologie, Permakultur, der (für-)sorgenden Bewirtschaftung von Gemeinschaftswäldern, ausgeklügelten Bewässerungssystemen und ähnlichen Praktiken zu tun hat, stellt sich genauer auf die Rhythmen ein, die die Natur erfordert, und lernt, die feinen Indikatoren zu lesen, die ihre Gesundheit bzw. ihre Gefährdung anzeigen. Je mehr Commoners direkt mit der Natur zu tun haben, desto engere, respektvollere Beziehungen mit der Erde als funktionierendem System entwickeln sie. Sie kann ihnen heilig werden.
In Commons-Umgebungen wird dieser Prozess deshalb unterstützt, weil hier der Schwerpunkt nicht auf dem Tauschwert des »Naturkapitals« geschweige denn der Finanzialisierung[17] der Natur liegt. Lassen wir noch einmal Kat Anderson zu Wort kommen. Als sie Älteste der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner in Kalifornien auf das Verschwinden mancher Pflanzen und Tiere ansprach, verwiesen diese auf »den Mangel an menschlicher Interaktion mit einer Pflanze bzw. einem Tier«. Sie waren der Auffassung, dass Menschen eine aktive Beziehung mit Pflanzen brauchen. Pflanzen, so erklärten sie, »profitieren nicht nur davon, genutzt zu werden, manche können tatsächlich davon abhängig sein, dass Menschen sie nutzen. Der Schutz gefährdeter Arten und die Restaurierung von Ökosystemen könnte die Wiedereinführung (für-)sorgender Bewirtschaftung notwendig machen anstelle eines Naturschutzes, der jegliche menschliche Interventionen einfach unterbindet«.[18]
Indigene Weisheit behauptet, dass Menschen mit der Natur als Pflegnutzende, (für-)sorgend Bewirtschaftende, ja sogar als »enlivener« – verlebendigende Akteure – interagieren müssen. Dieser Gedanke fließt durchaus in einige politische Maßnahmen ein. In Guatemala hatte die Regierung lange versucht, Menschen, die Vieh züchten, Landwirtschaft betreiben oder Holz fällen, daran zu hindern, Land im Maya-Biosphärenreservat zu zerstören. Nachdem klar wurde, dass sich dieses Verhalten kaum stoppen ließ, erkannten die Behörden, dass »die effektivste Art und Weise, Wälder zu schützen, ist, den bereits dort lebenden Gemeinschaften die Aufsicht darüber zu übertragen«.[19]
Dasselbe ist in Nepal geschehen. Dort hat die Beteiligung der Gemeinschaften an der Bewirtschaftung der Wälder den (für-)sorgenden, nachhaltigen Umgang deutlich verbessert. Nach 1990 wurden neue Regeln und Finanzierungsformen eingeführt, um selbstverwaltete Strukturen zu unterstützen. Heute bewirtschaften insgesamt 16.000 Gemeinschaften 1,2 Millionen Hektar Land. Das entspricht etwa einem Viertel der Waldfläche Nepals.[20]
Es geht also nicht darum, dass Staat und Wirtschaft einfach »nachhaltigere« Regeln entwickeln. Es geht darum, dass Menschen ihr Natursein leben und vertiefen. Dies ist der Keim, aus dem beispielsweise das strukturierte Wissen der Permakultur hervorgeht.
Es ist, in David Abrams Worten, »der Bann der sinnlichen Natur«, der uns tiefer mit der Natur und unserem eigenen Natursein verbindet.[21] »Wir sind vom gleichen Stoff« wie die Welt, schreibt der Ökophilosoph Andreas Weber, deshalb wirken ein Waldspaziergang oder der Frühlingsanfang so beglückend.[22] Unsere Verbindungen zur Natur sind so tief und existenziell, argumentiert er, dass unser inneres Selbst und unser Fühlen die Prägung der Außenwelt tragen. Alles was lebt, erfährt sich selbst als physische Materie auch im Innen, etwa durch Emotionen. Wir sind Teil eines größeren Dramas »biopoetischer« Beziehungen zwischen den Kreaturen der Welt. Deshalb ist es unabdingbar, unser Naturverbundensein zu vertiefen, wenn wir uns wirklich auf den Weg machen wollen zu einem (für-)sorgenden Umgang mit uns und mit dem, was uns trägt und umgibt.

Jegliches kooperative Unterfangen steht vor ernsten Herausforderungen, von denen viele auf das Verhalten Einzelner zurückzuführen sind. Konflikte sind unvermeidlich. Die Frage lautet nicht, ob sie angegangen werden, sondern wie. Sie zu ignorieren ist keine Option. Was wir mit »beziehungswahrend« meinen, lässt sich am besten im Anschluss an die Erkenntnisse von Elinor Ostrom erklären. Wie in allen Institutionen muss es auch in Commons Regeln und Normen geben, die für alle gelten. Für gelingendes Commoning ist dabei maßgeblich, wie diese durchgesetzt werden. Schließlich gibt es viele Zusammenhänge, aus denen sich Menschen nicht einfach zurückziehen können. Das macht das Anliegen, im Umgang mit Konflikten die »Beziehungen zu wahren«, so wichtig. Konflikte oder Regelverstöße sind offen und ehrlich zu thematisieren; mit einer Haltung des Respekts und des Sorgetragens für alle Beteiligten. Auch der Einsatz abgestufter Sanktionen, eines der Designprinzipien für langlebige Commons, kommt hier zum Tragen (siehe Kapitel 5, S. 138). Im beziehungswahrenden Umgang mit Konflikten ist zunächst zu beachten, den Schaden anzuerkennen und ihn dann – sofern möglich – zu beheben, wobei die Möglichkeiten und die Würde der Einzelnen nicht aus dem Blick geraten dürfen. Es ist wenig hilfreich, Menschen Wiedergutmachungsbürden aufzuladen, die sie nicht tragen können. Beziehungen könnten zudem gewahrt werden, wenn die kollektive Mitverantwortung oder systemische Probleme nicht unreflektiert bleiben.
Sanktionen sind nicht dazu da – oder sollten nicht dazu missbraucht werden –, auf indirektem Wege einen Konsens zu erzwingen, doch sie können dazu beitragen, grundsätzlichen Problemen und Fehlern vorzubeugen. Wenn Konflikte entstehen, können die Lösungen schrittweise umgesetzt werden, so dass immer wieder eine offene, transparente Auseinandersetzung über den Konflikt erfolgen kann. Eine beliebte und einfache Technik, dies zu tun, ist der Kreis (Runde Tische sind nicht umsonst Teil unserer politischen Geschichte!): Im Kreis – wir haben das mit mehr als hundert Menschen erlebt – kann eine problematische Situation bzw. ein problematisches Verhalten besprochen werden. Die Kunst besteht darin, allen das Recht einzuräumen, gehört zu werden, Zeugnis abzulegen und Änderungen vorzuschlagen – und gleichzeitig über das wahrgenommene Problem und seine Wirkungen offen zu reden. Das bedeutet nicht, dass alle reden müssen, aber es gibt die Möglichkeit, dies zu tun. So wie beispielsweise in den »Kreisgesprächen« von Mitgliedern des venezolanischen Kooperativenverbandes Cecosesola: Wenn man diese verfolgt, kann es angenehm verwundern, wie »Beschwerden« über Einzelne in einen Kontext von Wertschätzung eingebettet sind. Nach anstrengenden Reflexionen und dem Abschluss des Kreisgesprächs kommt es vor, dass »die Beschuldigten« von Einzelnen in den Arm genommen werden. Diese Gespräche sind trotzdem überaus schwierig, denn sie sind Ausdruck komplexer zwischenmenschlicher Konflikte und daher mit tiefen Emotionen verbunden – und doch signalisieren die Beteiligten durch ihre Wortwahl und die Umarmung am Ende ihre Wertschätzung. Die Fähigkeit, ehrliche Kritik mit Respekt und sogar Zuwendung zu verbinden, fällt nicht vom Himmel. Sie muss eingeübt werden. Vielleicht beginnt es damit, dass Eltern ihren Kindern auch dann einen Gute-Nacht-Kuss geben, wenn ein Streit vorausgegangen ist. Der Konflikt – so die Botschaft – ist es nicht wert, durch die Nacht getragen zu werden.
Andere Commons mögen Mediationen oder andere Beratungsformen nutzen, um mit Konflikten beziehungswahrend umzugehen. Viele Software-Commons haben die Möglichkeit, »den Code aufzuspalten« – in der Fachsprache »fork« genannt. Das spaltet letztlich auch das Projekt. Dies kann – im Umgang mit Streitigkeiten – beziehungswahrend sein oder auch nicht. Tatsache ist: eine oder mehrere Personen können so das Projekt getrennt weiterführen und dennoch auf derselben Software-Code-Grundlage arbeiten und es in andere kreative Richtungen weiterentwickeln.
Gewiss lässt sich nicht allen Konflikten auf diese Weise begegnen. Es mag einen Punkt geben, an dem die vollkommene Spaltung eines Projektes oder der Ausschluss einer Person die einzige praktische Option ist. Worum es jedoch geht und was sich stets lohnt, ist das Bemühen, die Einstellung zum Gemeinsamen zu erhalten und gleichzeitig wirklich ehrlich zu sein. Nichtwahrhabenwollen und Selbstbetrug helfen niemandem.
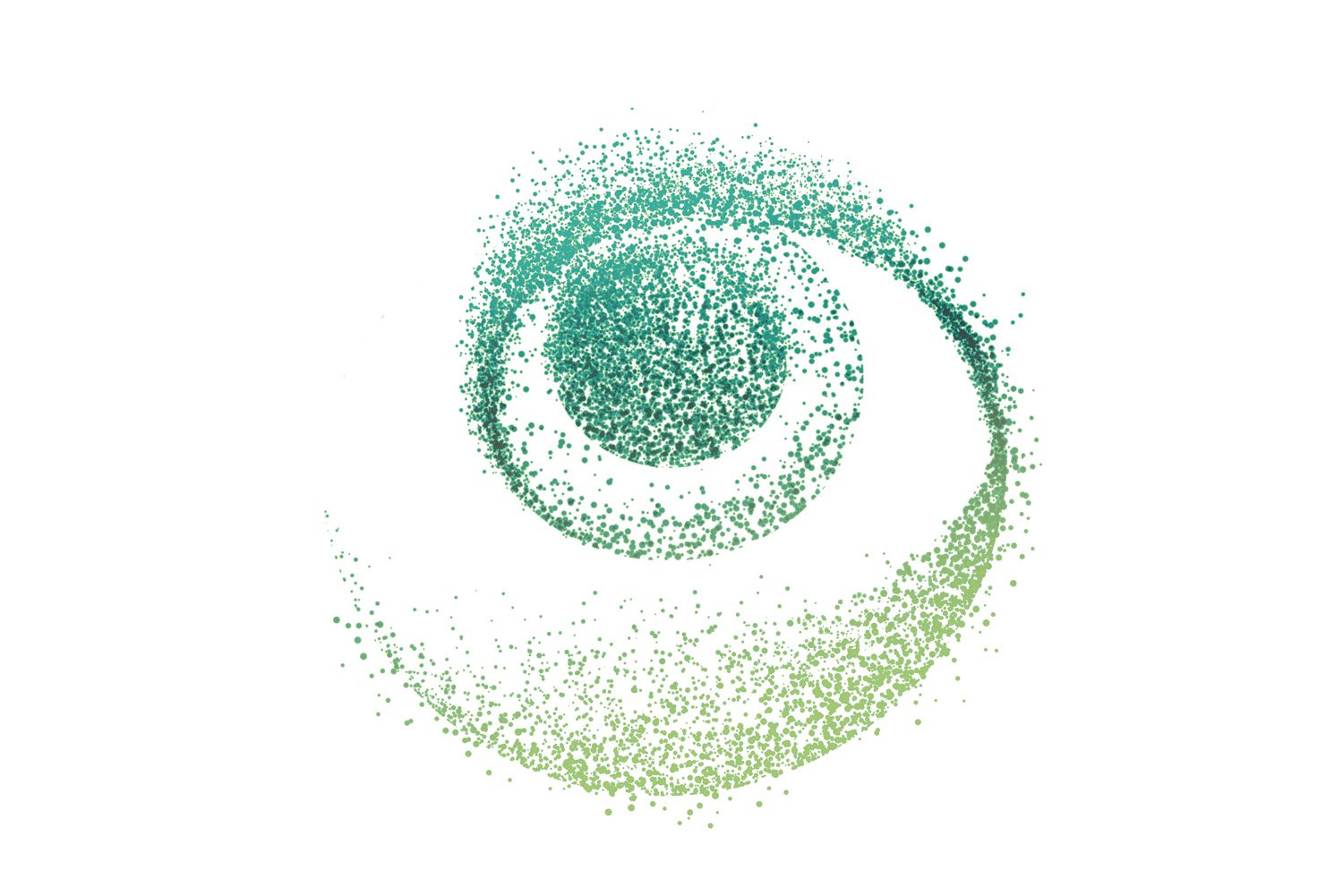
In vielen Commons sind sich die Beteiligten ihrer eigenen Praxis nicht wirklich bewusst. Oft bleibt der Kern der sozialen Dynamiken im Dunkeln. Das gilt für die konstruktiven wie für die weniger hilfreichen. Selbst engagierte Menschen können angesichts herausfordernder Organisationsstrukturen, der Zumutungen des täglichen operativen Geschäfts, der Notwendigkeiten und Verführungen des Geldverdienens, der Verlockungen der Macht und vieler anderer Faktoren vergessen, wie ein Commons zu erhalten ist. Das gefährdet das Ganze. Daher ist es unabdingbar, dass Commoners über ihre eigene Governance reflektieren. Nur so können sie Einhegungen, Vereinnahmungen oder institutioneller Entropie vorbeugen.
Wir ordnen dieses Muster dem sozialen Leben des Commoning zu und nicht der bewussten Selbstorganisation (Peer Governance), weil es so grundlegend für den sozialen Prozess ist. Der Ökonom Johannes Euler hat das auf den Punkt gebracht: So wie es kein Commons ohne Commoning gibt, gibt es auch kein Commoning ohne Peer Governance. (Oder anders ausgedrückt: So wie ein Gemeinsames nicht ohne gemeinsames Tun entsteht, gelingt gemeinsames Tun nicht ohne bewusste Reflexion der eigenen Organisationsformen.) Wenn ein Commons Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte überdauern soll, dann ist dieser Gedanke zentral: Formen des Commoning, deren sich die Beteiligten nicht bewusst sind, riskieren zu scheitern. Wenn nicht auf die stabilisierende Kraft jahrhundertealter Traditionen, Kulturen und Rituale zurückgegriffen werden kann, müssen Menschen klar ausdrücken können, warum ein Commons funktioniert und wie es verbessert werden kann.
Natürlich ist Commoning mehr als gesteigerte Bewusstheit oder tieferes Sein, wie wir das aus Zen- oder Achtsamkeits-Praktiken kennen. Es ist – um es noch einmal zu sagen – Bedingung und Mittel bedürfnisorientierten Wirtschaftens in bewusster Selbstorganisation. Es ist zudem der kulturelle Ausdruck einer neuen Art, Politik zu denken und zu machen. In seiner ambitioniertesten Form setzt Commoning einen Prozess in Gang, der uns erlaubt, die Bedingungen der modernen Zivilisation neu zu denken. Das ist nicht wenig in einer Zeit, in der sich der Homo oeconomicus als idealisierte Vorstellung menschlichen Strebens, als zutiefst gesellschaftsfeindlich, ökologisch blind und demokratischen Anliegen gegenüber gleichgültig erweist. Commoning setzt also einen Prozess in Gang, der das Kooperative und Mitfühlende in uns stärkt. Und eben dies ist der Effekt der bis hierhin beschriebenen Muster sowie all derer, die in Kapitel 5 und 6 folgen werden. Commoning verändert uns. Bevor wir uns mit den Fragen der Selbstorganisation auseinandersetzen, wollen wir diesem Gedanken noch etwas Aufmerksamkeit schenken.
Commoning entfaltet das Ich-in-Bezogenheit
Wer sich nur genug anstrengt, kann ein Vermögen anhäufen. Diese Erzählung vom »Selfmademan« (tatsächlich meist männlich) gehört zu den beliebten Gemeinplätzen unserer Zeit. Dabei ist die Vorstellung absurd, jemand könnte ohne Freundes- und Kollegenkreise, Familie oder Gesellschaft wirklich existieren oder erfolgreich sein. Es ist nichts weiter als ein »anpassungsfähiger, schädlicher und unverwüstlicher Mythos«, befindet ein Beobachter.[23] Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass sich ein Individuum nur durch den Austausch mit anderen entfalten und zum Selbst werden kann. Und umgekehrt: das Kollektiv kann nur durch die Beiträge und die freiwillige Zusammenarbeit von Einzelnen entstehen. Das erklärt, warum Anthropologen wie Thomas Widlok davon sprechen, dass wir nicht nur »miteinander verbundene Leben«, sondern »miteinander verschränkte Identitäten« haben (siehe Kapitel 2).[24] Mit anderen Worten, Individuen und Kollektive sind keine inkompatiblen Gegensätze wie die Luft und das Vakuum. Sie sind vielmehr verbunden und gegenseitig voneinander abhängig. Schon die Begriffe Individuum und Kollektiv selbst sind relational – sie sind nur in Bezug aufeinander sinnvoll und vermitteln erst durch einander ihre Bedeutung.
Ungeachtet dessen ist die Fantasie, dass Einzelne über alle und alles triumphieren können – à la Frank Sinatra: »I did it my way!« – nicht nur im Pop-Entertainment lebendig, sondern selbst in den seriösesten intellektuellen Kreisen: in der Evolutionswissenschaft, der Biologie, der Wirtschaftswissenschaft und anderen Sozialwissenschaften. Sie alle neigen dazu, das isolierte Individuum als selbstverständliche Kategorie des Denkens zu betrachten. Sie sehen das Selbst als unteilbare, umgrenzte Einheit, die autonom handelt. Das ist ein Ausgangspunkt – eine Grundannahme – aus der alles andere folgt: wie wir die Welt sehen, wie die Wissenschaft die Welt analysiert (methodologischer Individualismus), wie wir handeln, Institutionen entwerfen und Politik ausgestalten. So problematisch die Idee ist, so mächtig ist sie. Tatsächlich spiegelt sie sich in den bekannten Gegensätzen, die wir als gegeben voraussetzen: Individuum versus Kollektiv, öffentlich versus privat, objektiv versus subjektiv. Wie in Kapitel 2 beschrieben, wird in mehreren Bantu-Sprachen die Beziehung zwischen »mir« und »der/dem Anderen« mit dem Wort Ubuntu ausgedrückt.[25] »Ich bin, weil wir sind, und weil wir sind, deshalb bin ich.«[26] Das Individuum ist dabei nicht nur Teil eines »Wirs«, sondern vieler »Wirs«. Und auch wenn wir in westlichen Sprachen keine gute Entsprechung für Ubuntu haben, sind wir in der Lage, in diesem Geiste zu handeln: in eine Haltung des Dialogs zu gehen, unsere soziale Wirklichkeit zu reflektieren und zu erkennen, dass die Verbindung mit Anderen nicht nur Quelle der Identität, sondern auch ein soziales Sicherungsnetz ist. Wir können auf die Muster des Commoning achten, sie anwenden und damit nicht nur uns, sondern das Ganze verändern. Auf diese Weise, werden wir ganz konkret immer wieder neu, was wir im Grunde sind: Ich-in-Bezogenheit.
Als wir über die in unsere Sprache eingebetteten Voreingenommenheiten nachdachten und versuchten, uns davon zu befreien, stand plötzlich diese Wendung im Raum. Sie enthält und verbindet Ich und Wir. Sie kann die schweren Mängel des Homo oeconomicus hinter sich lassen und menschlichem Handeln sowie einer Identität als Commoner Ausdruck verleihen. »Ich-in-Bezogenheit« unterstreicht die vielen Beziehungen, die uns formen und umgeht den irreführenden Ich-versus-Wir-Dualismus, der unser Denken prägt.
Dass wir in Bezogenheit leben, ist nicht nur ein Gedanke, sondern sehr real. So beginnt etwa die westliche Medizin zu erkennen, dass ihre Fixierung auf einzelne Krankheitserreger ein irreführender Ansatz ist, um Erkrankungen zu verstehen. Einfache Ursache-Wirkungs-Erklärungen genügen oft nicht, denn einzelne lebendige Systeme – wie unser Körper – stehen in Beziehungen zu größeren lebendigen Systemen und bestehen gleichzeitig aus kleineren lebendigen Elementen. Also Ganzheitlichkeit auf allen Ebenen! Das Human Microbiome Project hat etwa 100 Billionen nicht-menschliche Lebensformen – Bakterien, Pilze etc. – ausfindig gemacht, die in unserem Körper, insbesondere unserem Verdauungstrakt, leben und mit zwei bis fünf Pfund zu unserem Körpergewicht beitragen. Diese Organismen sind für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden als »Individuen« lebensnotwendig. Nicht einmal unser eigener Körper hat eindeutige Grenzen. Das ist eigentlich eine philosophische Trivialität, denn ein Gegenstand ist ein Objekt des Denkens. Wenn man ihn (gedanklich) abgegrenzt denkt, dann ist er auch abgegrenzt. Doch diese Grenzen sind nicht unbedingt in der Wirklichkeit zu finden. Man ist – angesichts der ungezählten Lebewesen, die uns bevölkern – versucht zu sagen, dass wir uns selbst nicht allein besitzen. Wir sind auch im Besitz anderer Lebewesen. Unser Körper lebt in ständigen symbiotischen Beziehungen mit der Nahrung, die wir aufnehmen, mit den Bakterien in uns und um uns herum und mit der Landschaft vor Ort. Kurz gesagt, wir sind mehr als Substanz, wir sind auch Struktur, die über uns hinausgreift. Und als solche aquarellieren wir buchstäblich in ein Netzwerk anderer lebender Organismen und Systeme hinein.[27]
Der Begriff Ich-in-Bezogenheit versucht, diese weit über das Individuum hinausgehende Dimension einzufangen. Wenn wir dieser auch im Handeln gerecht werden, dann leben wir Ubuntu-Rationalität. Das heißt, dass ich die Belange Anderer in meine Handlungen einbeziehe. Das stärkt nicht nur mich, sondern den sozialen Zusammenhalt. Dies bewusst zu tun ist wichtig, weil unsere Handlungen ohnehin mit dem Tun und den Interessen anderer zusammenhängen. Meine Handlungen katalysieren immer auch Vorteile (genauso wie Nachteile) für Dritte; unser Tun wirkt durch andere hindurch. Unser Impuls zur Kooperation, von dem bereits in Kapitel 1 die Rede war, entsteht also nicht aus Berechnung, sondern entspricht zutiefst unserem Menschsein – deshalb ist Kooperation auch Quelle von Freude und Zufriedenheit.
Unser Ich-in-Bezogenheit zu stärken bedeutet, all dem Raum und Ausdruck zu geben, was jedes Commons enthalten muss: Zuwendung und Respekt, Frustration und Lachen, Spiel und Leidenschaft, Trauer und Liebe. All dies ist Teil der alltäglichen Routinen des Gemeinsamen. Ubuntu-Rationalität realisiert sich meist unspektakulär. Die am WikiHouse-Netzwerk Beteiligten beispielsweise (siehe Kapitel 1) sind eingeladen, ihre Entwurfsinnovationen »gemeinsam zu nutzen und für andere nutzbar zu machen«. Offene Standards und das Bausteinprinzip ermuntern alle, etwas Eigenes ohne Zwänge beizutragen. Einzelne beteiligen sich so an einer Sache, die größer ist als sie selbst, und profitieren zugleich davon. Ähnlich ist es bei den Verbund-Wikis, auch sie erfüllen die Idee des Ichs-in-Bezogenheit mit Leben. Die Einzelnen sind so frei, persönliche Wikis nach eigenen Vorstellungen zu schaffen – online und offline-, und sie können solche problemlos in größere Verbünde – »Nachbarschaften« genannt – platzieren, die Nutzerinnen und Nutzer ermutigen, ihre Wiki-Seiten mit anderen zu teilen (siehe Kapitel 8).
Angemerkt werden muss, dass das Verhältnis von kollektiver Steuerung bzw. Kontrolle und individuellen Anliegen nicht immer gut austariert ist. Eine Gruppe mag für manche Personen erdrückend wirken. Sie fühlen sich unwohl und ziehen sich zurück. Patriarchale Strukturen wirken auch in vielen Subsistenz- und digitalen Commons. Zwangskonformismus kann aus einer Gemeinschaft schnell eine Sekte machen. Charismatische Führungspersönlichkeiten mögen etwas durchsetzen und Macht konsolidieren, doch geht dies zu Lasten einer robusten Kultur des Gemeinsamen. In Commons-Strukturen als Ich-in-Bezogenheit zu agieren ist herausfordernd. Eine Ubuntu-Rationalität zu pflegen erfordert eine kunst- und respektvolle Balance zwischen den Bedürfnissen Einzelner und den Notwendigkeiten der Gruppe, des Netzwerks und des Ganzen. In gewisser Weise geht es bei allen Mustern des Commoning, die wir in diesem Buch vorstellen, darum, dieser Herausforderung zu begegnen und dadurch unsere Existenz als Ichs-in-Bezogenheit anzuerkennen und zu stärken.
Anmerkungen
- Pascal Gielen: »Introduction: There’s a Solution to the Crisis«, in: Pascal Gielen (Hrsg.), No Culture, No Europe – On the Foundations of Politics, Amsterdam: Antennae Valiz, 2015, S. 22. ↩
- .K. Gibson-Graham: The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996/2006, S. xvi.↩
- Pascal Gielen, a.a.O., S. 14. ↩
- Im Kartoffelpark, im Cusco Tal, werden circa 7.000 Kartoffelsorten durch Anbau geschützt. Kultiviert werden aber auch weitere einheimische Lebensmittel aus der Andenregion: Bohnen, Mais, Quinoa, Weizen, Andenlupinen, die knollige Kapuzinerkresse oder der knollige Sauerklee, auch Oka oder Yam genannt.↩
- In seinem Buch Lean Logic über Vorstellungen einer postkapitalistischen Kultur hebt David Fleming die Bedeutung des Karnevals hervor: »Feiern mit Musik, Tanz, Fackelschein, Pantomime, Spielen, Festessen und Narrheiten sind stets für das Leben von Gemeinschaften zentral gewesen, außer in den Zeiten, in denen die Ansprüche der großmaßstäblichen Zivilisation sich wie ein Frost auf die öffentliche Freude niederlegte.« Er benannte die Wichtigkeit, einen »radikalen Bruch« mit »der Normalität des Arbeitstages/Arbeitsalltags« zu inszenieren; die Notwendigkeit, »die Lebhaftigkeit des Herzens des gezähmten, domestizierten Bürgers« zum Ausdruck zu bringen; sowie Rituale von »Opfer-und-Nachfolge«, die die Geburt und Erneuerung der Gemeinschaft symbolisieren, obwohl Individuen aus der Gemeinschaft sterben. David Fleming: Lean Logic, White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing, 2016, S. 30. ↩
- https://konglomerat.org/. ↩
- E.P. Thompson: Customs in Common, London: Penguin Books, 1993, S. 159. ↩
- Uskali Mäki: The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics, Cambridge, England: Cambridge University Press, 2001. ↩
- Margaret Stout: »Competing Ontologies: A Primer for Public Administration«, Public Ad- ministration Review, 72(3), Mai/Juni 2012, S. 388-398. 10 | Feministische Politologinnen, wie Carole Pateman in ihrem Buch The Sexual Contract (1988), haben darauf hingewiesen, dass bereits die Idee eines modernen Gesellschaftsvertrags patriarchale Setzungen widerspiegelt: etwa die Autonomie des Einzelnen, die vorgebliche Gleichheit aller beim Aushandeln eines fairen Vertrags oder die angenommene Abgetrenntheit und Minderwertigkeit des privaten Bereichs.↩
- Feministische Politologinnen, wie Carole Pateman in ihrem Buch The Sexual Contract (1988), haben darauf hingewiesen, dass bereits die Idee eines modernen Gesellschaftsvertrags patriarchale Setzungen widerspiegelt: etwa die Autonomie des Einzelnen, die vor gebliche Gleichheit aller beim Aushandeln eines fairen Vertrags oder die angenommene Abgetrenntheit und Minderwertigkeit des privaten Bereichs.↩
- Eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Evolution des westlichen Denkens in Wissenschaft und Recht sowie ihrem Bezug zu Commons findet sich in Fritjof Capra und Ugo Mattei: The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, Oakland, California: Berrett-Koehler, 2015.↩
- Carl Schmitt in Der Begriff des Politischen: »Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Nicht nur ihrer historischen Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre übertragen wurden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum omnipotenten Gesetzgeber wurde, sondern auch in ihrer systematischen Struktur [...]«. Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 8. Auflage, Berlin: Duncker & Humblot, 2004, S. 43. ↩
- Stout, Public Administration Review, a.a.O., S. 393. ↩
- James Buchanan: The Economics and the Ethics of Constitutional Order, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1991, S. 14.↩
- Andreas Karitzis: »The Decline of Liberal Politics«, in: Anna Grear und David Bollier, The Great Awakening (im Erscheinen, 2019).↩
- Arturo Escobar: Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Durham, North Carolina: Duke University Press, 2018.↩
- Stout, a.a.O., S. 389.↩
- Sam Lavigne: »Taxonomy of Humans According to Twitter«, The New Inquiry, 7. Juli 2017, https://thenewinquiry.com/taxonomy-of-humans-according-to-twitter/.↩
- Cathy O’Neil: Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, New York: Crown, 2016. ↩
- Brian Massumi: Ontopower: War, Powers and the State of Perception, Duke University Press, 2015.↩
- Anne Salmond: »Der Urquell der Fische. Ontologische Kollisionen auf See«, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, Bielefeld: transcript Verlag, 2015, S. 297-316, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons↩
- Andrea J. Nightingale: »Subjektivität, Emotion und (nicht) rationale Commons«, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, Bielefeld: transcript Verlag, 2015, S. 285-296, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons↩
- Das ist eine Metapher, die Ludwig Wittgenstein in Bezug auf Ontologien verwendete.↩
- Siehe z.B. Vijaya Nagarajan: »On the Multiple Language of the Commons: A Theoretical View«, Worldviews 21, 2017 S. 41-60. ↩
- Marilyn Strathern: The Gender of the Gift, Berkeley: University of California Press, 1988, S. 13. Wir sind Lewis Hyde dafür zu Dank verpflichtet, dass er uns auf die Arbeiten von Strathern, Marriott und LiPuma aufmerksam gemacht hat. ↩
- Ebd., S. 349.↩
- Ebd., S. 165. ↩
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Teil 1 – Commons grundlegen
- Teil 2 – Commons verstehen und leben
- Einleitung: Die Triade des Commoning
- Kapitel 4: Soziales Miteinander
- Kapitel 5: Selbstorganisation durch Gleichrangige
- Kapitel 6: Sorgendes & selbstbestimmtes Wirtschaften
- Teil 3 – Das Commonsversum
- Einleitung: Wie das Commonsversum wachsen könnte
- Kapitel 7: Eigentümlich denken
- Kapitel 8: Haben & Sein
- Kapitel 9: Commons im Staat
- Kapitel 10: Commons erMächtigen
- Anhang
- Danksagung