Teil 2 – Commons verstehen und leben
Kapitel 5: Selbstorganisation durch Gleichrangige
Kapitelüberschriften
Commoning zeigt sich, wie in Kapitel 4 beschrieben, in verschiedenen Haltungen und Verhaltensweisen. Aber taugt es auch als Organisationsweise oder zur Regulierung und Lenkung sozialer Prozesse? Lassen diese sich durch Commoning gar besser steuern als durch Regierungen und Verwaltungen? Gelingt die Koordination durch Commoning besser und effektiver als durch den Markt? All das sind sehr weitreichende Fragen, aber zunächst werden wir genauer betrachten, wie bewusste Selbstorganisation innerhalb eines Commons funktioniert.
Der Rechtswissenschaftler Robert Ellickson beschäftigt sich unter anderem mit Eigentumsfragen. So untersuchte er, wie die Viehzüchter im kalifornischen Shasta-Tal mit dem Problem umgingen, dass Vieh von ihren Feldern ausgebrochen und in das Land anderer eingedrungen war. Sie haben dafür ihre eigenen Regeln und sozialen Normen entwickelt. Ellickson nennt dies »Ordnung ohne Gesetz«. [1] So folgen benachbarte Rancher oft der Tradition, sich die Kosten für den Bau und die Instandhaltung eines gemeinsamen Zauns zu teilen, halbe-halbe. Oder sie einigen sich darauf, dass ein Viehzüchter das Material und der andere die Arbeitskraft für das Ziehen des Zauns zur Verfügung stellt. Wenn aber ein Viehzüchter eine höhere durchschnittliche Viehdichte auf seiner Seite des Zauns hat, will es der Brauch, dass es in der Aufteilung des Aufwandes für den Zaun eine grobe »Norm der Verhältnismäßigkeit« gibt. Verstößt ein Rancher unvorsichtigerweise gegen die Norm, dass streunende Rinder eingeholt werden müssen, wird in der Ranchergemeinschaft oft absichtlich getratscht, um sie zu beschämen (siehe Regeleinhaltung commons-intern beobachten & stufenweise sanktionieren).
Eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk ist mit einem Problem konfrontiert, und die Beteiligten entwerfen eine Lösung. Dann beginnt der kompliziertere Teil der Aufgabe: die Lösungsidee in die Realität umzusetzen. Es ist daher wichtig zu verstehen, welche Dynamiken in der täglichen Praxis einzelner Commons immer wieder anzutreffen sind. Das hilft nicht nur anderen, es inspiriert auch unser Nachdenken darüber, wie größere Strukturen funktionieren können, etwa Commons-Verbünde, commons-freundliche Gesetze oder commons-basierte Infrastrukturen. Zudem ist es nützlich, um die Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren commons-freundlich auszurichten. Auf den folgenden Seiten stellen wir deshalb – nach einigen Ausführungen zum Begriff »Governance« – zehn Muster dieser Lenkungsform vor, die wir Peer Governance nennen. Die ersten sieben haben mit direkten zwischenmenschlichen und anderen sozialen Beziehungen zu tun, die letzten drei mit commons-basierten Methoden des Umgangs mit Eigentum, Märkten und Geld. Hier die Übersicht:
Muster der Peer Governance
Sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten
Commons mit halbdurchlässigen Membranen umgeben
Im Vertrauensraum transparent sein
Wissen grosszügig weitergeben
Gemeinstimmig entscheiden
Auf Heterarchie bauen
Regeleinhaltung commons-intern beobachten & stufenweise sanktionieren
Beziehungshaftigkeit des Habens verankern
Commons & Kommerz auseinanderhalten
Commons-Produktion finanzieren
Anmerkungen zu »Governance«
Der Begriff »Governance« wurde historisch mit der eher statischen, langsamen Welt des späten 18. und des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht. Mitteilungen wurden vor allem von Pferden, später mit der Eisenbahn und per Telegrafenleitung transportiert. Damals entstanden der moderne Nationalstaat und die kapitalistische Marktwirtschaft. Heute ist ein Großteil der Welt, einschließlich abgelegener Regionen, hochgradig vernetzt, mobil und schnelllebig. Die Verbundenheit der Menschen mit bestimmten Regionen und lokalen Gemeinschaften nimmt vielerorts ab. Dies beeinflusst unser Nachdenken über die Lenkungs- und Regierungsformen der Zukunft.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die sich auf vielfältigen Wegen durchsetzenden Lenkungsprozesse (engl. governance ; Frz. gouvernance) oft nicht sauber unterschieden von der Regierung (engl. government). Dabei verweist der Begriff Governance gerade darauf, dass innerhalb eines Gemeinwesens verschiedene Steuerungsmechanismen und -akteure existieren. Entscheidungen, Konfliktlösungen und Sanktionen, die das Gemeinwesen betreffen, gehen nicht ausschließlich von Amtsstuben aus. Ungeachtet dessen wird Governance in der Praxis zumeist als die Herrschaft einiger über viele verstanden und mit »Regierung« in Verbindung gebracht. Diese verfügt über die Autorität, Kontrolle auszuüben – und nutzt dazu von der Legislative verabschiedete Gesetze, von Richtern gefällte Urteile und politische Programme jener Politikerinnen und Politiker, die die Regierung stützen. Die Verwaltung mit ihrem Heer von öffentlichen Bediensteten ist mit der konkreten Umsetzung und Steuerung betraut. Unterm Strich betrachten viele diese Art der politischen Steuerung als etwas, das uns gewöhnlichen Menschen fern ist und dem wir schlimmstenfalls gleichgültig sind. Lenken ist in dieser Wahrnehmung etwas, das mit Macht ausgestattete Menschen für andere Menschen tun bzw. ihnen antun, mit – oder auch ohne – deren Beteiligung und Zustimmung. Aber zu lenken und zu regulieren im Sinne von Governance lässt sich weiter fassen als: zu regieren oder gar durchzuregieren. Es sind, wie gesagt, zwei unterschiedliche Dinge. Man könnte es so ausdrücken: In Commons gibt es Lenkungsformen (Governance), jedoch keine Regierung.
Im Nachdenken darüber, wie diese Formen aussehen und wie Koordination in Commons funktioniert, erschien uns der Begriff Governance dennoch unpassend. Unter anderem deshalb, weil er so eng mit der Idee verknüpft wird, dass kollektive Interessen auf der einen Seite gegen individuelle Freiheiten auf der anderen Seite stehen. Dieser vermeintliche Gegensatz ist derart tief verwurzelt, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, wie er ernsthaft aufgelöst werden könnte. Und doch ist das möglich. Die Grundidee: Individuellen Bedürfnissen kann entsprochen werden, indem wir kollektive Probleme kollektiv anpacken. Der selbst geschaffene Dualismus zwischen dem Kollektiv und dem Individuum ist weitgehend dadurch überwindbar, dass alle, die von Entscheidungen direkt betroffen sind, an den Governance-Prozessen beteiligt werden. Entscheidungsbefugnisse, Macht und Verantwortung im Entscheidungsvollzug sind so verteilt, dass alle Betroffenen tatsächlich Entscheidungen einbringen, abwägen und treffen können. Deswegen sprechen wir von Peer-Governance. Dies bezeichnet einen fortdauernden, dialogorientierten Prozess der Koordination und der Selbstorganisation unter Gleichrangigen. Als Lenkungsform beruht er auf der Anerkennung der Idee, dass wir in erster Linie Ich-in-Bezogenheit sind. Peer-Governance unterscheidet sich daher von jenen Lenkungsformen und -mechanismen, die wir in nationalstaatlichen Kontexten erleben. Jede und jeder Einzelne kann als aktiv gleichrangig anerkannt werden und nicht als Kontrahentinnen oder Kontrahenten in einer politischen Auseinandersetzung, die zudem einen großen, entfernen Dritten – die Regierung – kontrollieren wollen. Zwar sind wir Bürgerinnen und Bürger auch im modernen Nationalstaat nominal der Souverän, aber diese Souveränität wird delegiert. Sie wird gewissermaßen »wegvertreten« an das gewählte Parlament sowie an tendenziell rigide, oft als »bürgerfern« erlebte Verwaltungen. Das Regierungshandeln wird einerseits überfrachtet mit Erwartungen und kann andererseits nur grob beaufsichtigt werden – in manchen Ländern sind selbst dafür die Institutionen zu schwach. Selten erleben wir uns selbst als Souverän. Kein Wunder, dass der Staat von vielen als fremd oder gar feindselig betrachtet wird!
Peer Governance ist eher geeignet, auf die spezifischen Probleme und Bedürfnisse vor Ort einzugehen. Damit dies gelingt, bedarf es letztlich eines kunstvollen Zusammenspiels zwischen politischer Kultur und Struktur. Wenn gemeinsame Motivationen und Anliegen der Menschen gefördert werden sollen, dann sind dafür gute rechtliche Bedingungen – formell wie informell – genauso notwendig wie geeignete Finanzierungs- und Organisationsformen. Zugleich muss es ausreichend Freiraum geben, damit die Beteiligten individuell kreativ werden, einen lebendigen Austausch und eine Kultur gemeinsamen Handelns und Produzierens (siehe Kapitel 6) entwickeln können. Das wiederum wirkt positiv auf die Formen der Organisation und der Finanzierung zurück, denn gesammelte Erfahrungen können immer wieder zeitnah eingespeist werden. Wenn ein Commons kohärent und von Dauer sein soll, benötigt es eine (oder mehrere) klare Regeln; wenn es resilient und lebendig sein soll, muss es einladend sein – das heißt Spielraum, Flexibilität und Neuartiges bieten. Man könnte sagen, dass der informelle und kreative Anteil durch stützende und rahmende Strukturen stabilisiert werden muss, ohne von ihnen kontrolliert zu werden. Commoners müssen Handlungsweisen austüfteln, in der das Zusammenspiel zwischen Struktur und Kultur stimmt – weder das eine noch das andere darf überwiegen oder zu kurz kommen. Das ist die hohe Kunst der Governance in Commons.
Wie kommt es aber überhaupt zu einer Selbstorganisation, und wie reift sie zu einem stabilen, kreativen sozialen Organismus? Gibt es eine typische Form von Entwicklung, die durchlaufen werden muss? Wir glauben es nicht, aber es gibt Muster, die dazu beitragen, dass sich Commons durch bewusste Selbstorganisation erhalten. Es wäre falsch, selbige formelhaft be- und vorschreiben zu wollen. Formeln funktionieren in komplexen Systemen ohnehin genauso wenig, wie ein Commons sich dadurch fabrizieren lässt, dass man einige Menschen zusammenbringt, bestimmte Werte annimmt, operationelle Regeln und Strategien ihrer Durchsetzung anwendet, nur weil das gemeinhin empfohlen wird. Natürlich ist es hilfreich, die acht berühmten Designprinzipien nach Elinor Ostrom zu berücksichtigen, aber es wird nicht ausreichen, um flexibel auf Rückkopplungsschleifen in dynamischen Systemen reagieren zu können (siehe S. 48f.). Gleichwohl haben uns diese Designprinzipien im Nachdenken über die Koordination in Commons stark beeinflusst.[2] In unserer Analyse gehen wir jedoch in mehrfacher Hinsicht über sie hinaus, indem wir Aspekte aufgreifen, die in den Designprinzipien unberücksichtigt bleiben.
Zunächst einmal betrachten wir alle Arten zeitgenössischer Commons, nicht vorrangig solche, die sich um die Bewirtschaftung von Naturreichtümern drehen. Wir schauen auch auf Commons in digitalen und städtischen Umgebungen. Zudem verlassen wir dabei den üblichen Fokus auf Fragen der »Ressourcenbewirtschaftung und -allokation«, denn Commons sind aus unserer Sicht nicht primär eine ökonomische Angelegenheit – wir betonen die Kultur des Commoning. Und schließlich glauben wir, dass jegliche Einordnung selbstbestimmter Governance im Kontext ihrer systematischen Gefährdungen durch Märkte und staatliche Macht erfolgen muss. Peer Governance spielt eine Rolle als politische Gegenkraft. Das wollen wir sichtbar machen. Dabei ist für uns klar, dass bewusste Selbstorganisation unter Gleichrangingen auf allen Ebenen selbst lebendig sein muss. Auch deswegen sind die folgenden Muster weder vollständig noch als formelhafte Vorschriften zu verstehen. Es sind eher Verfahrensleitlinien, die Menschen in Gemeinschaften, Netzwerken und Verbünden dabei helfen, sich Schritt für Schritt und unter Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten auf Augenhöhe zu organisieren. Vergleichbar ist das – wie gesagt – mit der DNA, die nicht präzise vorfestlegt, wie die Entwicklung und Differenzierung des je konkreten Embryos ablaufen wird. »Enthält bereits die DNA eine vollständige Beschreibung des Organismus, den es hervorbringen wird?« fragt der britische Biologe Lewis Wolpert. »Die Antwort lautet nein. Das Genom enthält stattdessen ein Programm mit Anweisungen, wie der Organismus hervorzubringen ist – ein schöpferisches Programm.«[3]
Die schlechte Nachricht lautet also: Es gibt keine Blaupause und kein Patentrezept für Peer Governance. Es gibt keine Checkliste. Und es gibt kein ausführlich beschriebenes Regelwerk, nach dem zu verfahren ist, um Commons zu koordinieren oder »Ressourcen zu bewirtschaften«. Die gute Nachricht lautet: Peer Governance ist ein schöpferischer Prozess. Als solcher bietet er eine verlässliche Orientierung, um authentische, lebendige Beziehungen unter den Beteiligten aufzubauen und kohärente sowie stabile Commons zu entwickeln. Auch in diesem Gedankengang folgen wir Christopher Alexander. Anhand vieler Beispiele beschreibt er – ohne vorzuschreiben –, wie Räume und Strukturen dauerhafter Lebendigkeit geschaffen werden. Was Lebendigkeit hervorbringen soll, so Alexander, müsse selbst lebendig sein. Das sei »die EINZIGE Möglichkeit«. »Lebendige Struktur ... lässt sich nicht mit brachialer Gewalt herbeidesignen. Sie kann nur aus einem schöpferischen Programm entstehen ... sodass Konzeption, Plan, Entwürfe, detaillierter und struktureller Art und materielle Details alle Schritt für Schritt im VERLAUF DES PROZESSES entfaltet werden«[4] (Hervorhebung im Original).
Formale Strukturen sind zweifellos notwendig, aber lebendige Prozesse, die ihrer eigenen Logik folgen, bilden den Kern eines Commons. Commoning bedeutet ja, dass Menschen situationsspezifische Formen bewusster Selbstorganisation auf Augenhöhe verwirklichen und dabei Möglichkeiten entwickeln, um selbstbestimmt Nützliches und Sinnvolles für sich und andere herzustellen. Das erfordert kreative Handlungskompetenz, um Lösungen zu entwickeln, die ihnen fair und wirksam erscheinen. Es erfordert aber auch, mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten zu leben. Bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige ist derjenige Bereich des Commoning, in dem es um Entscheidungsfindung, Grenzziehungen, Regeldurchsetzung und den Umgang mit Konflikten geht.
Bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige – also Peer Governance – ist auf Dauer angelegt. Ihre konkreten Aspekte und Umsetzungsschritte können jedoch nicht in vollem Umfang vorbestimmt werden. Das ist eine Herausforderung für konventionelle Auffassungen von Governance, nach denen Blaupausen entwickelt werden sollen, die in sehr verschiedenen Kontexten anwendbar sind. Große wie kleine Betriebe werden mit gleichem Maß gemessen, ein Dorf bäcker muss dieselben Inhaltsanalysen auf seine Nudelpackungen aufkleben wie ein industrieller Pasta-Hersteller und wird mit diesem über einen Gesetzeskamm geschert. Tatsächlich sind Einförmigkeit und Vereinfachung wichtige Anliegen moderner Regulierungsformen[5], und zwar aus Gründen der Kontrollierbarkeit. In Seeing Like a State (1998) analysiert James Scott brillant, wie diese Anliegen die Ausübung moderner staatlicher Macht seit jeher durchziehen. Vereinfachung ist Voraussetzung für die effiziente Kontrolle sozialer Prozesse. Moderne Systeme greifen dafür auf vorfestgelegte Indikatoren, Entwicklungskennzahlen und Expertenwissen zurück. Die Geschichte der 3-Prozent-Haushaltsdefizitgrenze, die ganze Volkswirtschaften in Schach hält, macht das deutlich. Der Wirtschaftsjournalist Christian Schubert (FAZ) beschreibt, wie sie von einem »unbekannten Staatsdiener«[6] erfunden [sic!] wurde.[7] Warum, fragte sich Schubert, »sind es genau 3 Prozent, warum nicht 2,5 Prozent oder 3,5 oder 4 Prozent?« Der ehemalige Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer bestätigte ihm, dass dies »ökonomisch ... nicht leicht zu begründen« sei.[8] Auf der Suche nach politischen Gründen landete Schubert in einem Hinterzimmer des französischen Finanzministeriums und im Jahr 1981. Damals suchte François Mitterrand nach Wegen, das zentralstaatliche Haushaltsdefizit unter Kontrolle zu behalten. Er beauftragte kurzerhand die Budgetabteilung des Finanzministeriums. Sie sollten eine Lösung vorschlagen, »eine Art Regel, etwas Einfaches, das nach volkswirtschaftlicher Kompetenz« klinge, wird Mitterrand zitiert. Zwei Mitarbeiter des Ministeriums werden beauftragt. Ihre Ausbildung verweist darauf, dass sie Wirtschaft in erster Linie als Welt von Statistiken und Zahlen begreifen. Einer der beiden, Guy Abeille, damals noch keine 30 Jahre alt, berichtete, wie schnell ihnen das Bruttoinlandsprodukt als Referenzgröße plausibel erschien. Auch, weil es allen plausibel erscheinen würde. Die Frage nach der Prozentzahl beantwortet er so: »Wir steuerten damals auf die 100 Milliarden Francs Defizit zu. Das entsprach rund 2,6 Prozent des BIP. Also sagten wir uns: 1 Prozent Defizit wäre zu hart und unerreichbar gewesen. 2 Prozent hätte die Regierung zu stark unter Druck gesetzt. Also kamen wir auf 3 Prozent.« In anderen Worten, das Haushaltsdefizitkriterium entstand als Umstandskriterium, theorie- und substanzlos. Doch seit es seine Reise um die Welt angetreten hat und die Politik nicht müde wird, es zu verkünden, schafft es eine Wirklichkeit, die sich dem Kriterium beugt – seit 1981 in Frankreich, seit dem Abschluss des Vertrags von Maastricht 1992 in ganz Europa und anschließend darüber hinaus. Jean-Claude Trichet, der spätere Präsident der Europäischen Zentralbank, hatte die 3 Prozent schließlich nach Europa empfohlen: »Die Regel war einfach und für alle verständlich«, zitierte ihn die FAZ. Die politische Steuerung folgt der Erfindung. Das europäische Haushaltsüberwachungsverfahren sieht gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumspakt die Einhaltung der Maastricht-Kriterien vor, zu der die Haushaltsdefizit-Grenze gehört. Übermäßige Neuverschuldung soll auf diesem Wege vermieden werden. Zwischen 1999 und 2015 gelang es gerade drei Mitgliedsstaaten, das Defizit nie über 3 Prozent des BIP ansteigen zu lassen.[9] So wird Politik mehr oder weniger geschickt fabriziert. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf Kennzahlen, Indikatoren und Kriterien. All das ist Energie, die einer situationsbezogenen Governance, in der kreative Anpassung und schrittweise, prozessorientierte Umsetzung im Mittelpunkt stehen, entzogen wird.
Genau darauf aber sind Commons – ist Peer Governance – angewiesen. Sie müssen allmählich wachsen, sodass trotz unzähliger und unvorhersagbarer Unsicherheiten eine Kultur des Vertrauens und der Transparenz entstehen kann. Dies setzt ein Netzwerk an Beziehungen voraus – und Geduld. Um eine Kultur des Commoning zu etablieren, müssen manche Gewohnheiten (diese mächtigen, unsichtbaren Institutionen!) aufgebrochen werden und andere zu Traditionen heranreifen. Daher müssen Commoners ihre Governance-Systeme bewusst gestalten. Zur Erinnerung: Es gibt kein Commoning ohne Peer Governance.
Diese Gestaltung kann weder präzise noch beliebig sein. Doch es gibt Regelmäßigkeiten, deren wir uns vergewissern können. Es ist so, als würden wir im Freien ein Feuer entfachen. Es gibt keine einzige, stets korrekte Art und Weise, das zu tun. Und dennoch ist es sinnvoll, bestimmte Handlungsabläufe zu kennen und sie – bestenfalls – in einer gewissen Reihenfolge zu vollziehen. So wird man zunächst brennbares Material verschiedener Größe sammeln – Holzscheite, Anmachholz, Zunder – und es anschließend so anordnen, dass das leicht entzündliche Material unten liegt, sodass es hilft, die größeren Holzstücke zu entzünden. Mit einem Streichholz, einem Feuerzeug oder anderen Mitteln muss ein Funken gezündet werden. Es muss zudem ein begrenztes Behältnis für das Feuer geben – eine Feuerstelle, einen Ring aus Steinen oder einen tragbaren Grill – sowie ausreichend Luftzufuhr und Sauerstoff. Die Einzelheiten unterscheiden sich, je nachdem, ob man in der Nähe eines Waldes Feuer macht oder in der Wüste, wo das Brennmaterial knapp ist. Und natürlich wird auch das Ergebnis unterschiedlich sein – ein prasselndes Lagerfeuer, ein Feuer, das zum Kochen geeignet ist oder langsam vor sich hin glimmende Glut. Worauf es ankommt, ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Feuer zu entfachen, doch die grundlegenden Muster sind dieselben.
Dasselbe gilt für die bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige: Es gibt einige verlässliche allgemeine Muster und sehr viele spezifische Möglichkeiten, sie umzusetzen. Commons beginnen meist mit gemeinsamen Motivationen oder Anliegen der Beteiligten: der Notwendigkeit, die Felder zu bewässern; dem Wunsch von Software-Programmierfachleuten, mit nutzungsfreundlichen und freien Kartierungsprogrammen zu arbeiten; der Erfordernis, fairen Zugang zu einem Fischereigebiet zu sichern. Was auch immer das spezifische Problem sein mag: Wenn ein Commons entstehen soll, muss es Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen eine glaubhafte Vision anbieten, wie sie das Problem gemeinsam angehen können. Selbst wenn es noch keine klaren Strategien oder Lösungen gibt, muss in der Frühphase ein Funken entstehen und der notwendige Luftzug dazu führen, dass sich das Feuer entwickelt, das die notwendige Leidenschaft fördert. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass der Prozess ihren Bedürfnissen und ihrem Kontext entspricht, werden sie sich beteiligen wollen. Allerdings muss es etwas »Anziehendes« geben, das dazu anregt, sich selbst zu organisieren und ihre Absichten und Handlungen miteinander in Einklang zu bringen.[11]
Muster bewusster Selbstorganisation durch Gleichrangige
Während unserer analytischen Wanderungen durch die Welt der Commons haben wir zehn Muster für gelingende Peer Governance, also der Selbstorganisation durch Gleichrangige, ausfindig gemacht. Sie können nicht nur Interessierten aufzeigen, was zu beachten ist, wenn transparente Beratungs- und Koordinierungsprozesse etabliert werden sollen, sie erläutern auch, wie eine Commons-Governance tatsächlich funktioniert – im Unterschied zu Markt und Staat. Wenn Commons gelingen, dann meist, weil die Beteiligten in der Lage sind, Autorität und Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen und Machtmissbrauch oder Machtkonzentrationen zu verhindern. Darauf sind diese Muster ausgerichtet. Bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige gelingt, wenn Wissen großzügig weitergegeben wird, sodass die besten Ideen sich entfalten können und die Weisheit der Vielen zum Tragen kommen. Aber auch klare Überwachungs-, Sanktions- und Durchsetzungsregeln sind erforderlich, um Commons gegen Trittbrettfahrerei, Vandalismus oder Einhegungen zu schützen. Am wichtigsten: Wege zu finden, die verhindern, dass individuelle Eigentumsrechte und die verführerische Macht des Geldes das Gemeinsame unterlaufen. Commoners müssen deshalb die Beziehungshaftigkeit des Habens verankern – das Thema werden wir in Kapitel 8 genauer erkunden. Ähnlich wichtig sind die Herausforderungen hinsichtlich des Umgangs mit Märkten und Kapital. Commons sind nicht überlebensfähig, wenn die Normen des Kommerzes sie kolonialisieren. Daher ist es wichtig, Commons & Kommerz auseinanderzuhalten. Wir müssen jedes Muster einzeln untersuchen.
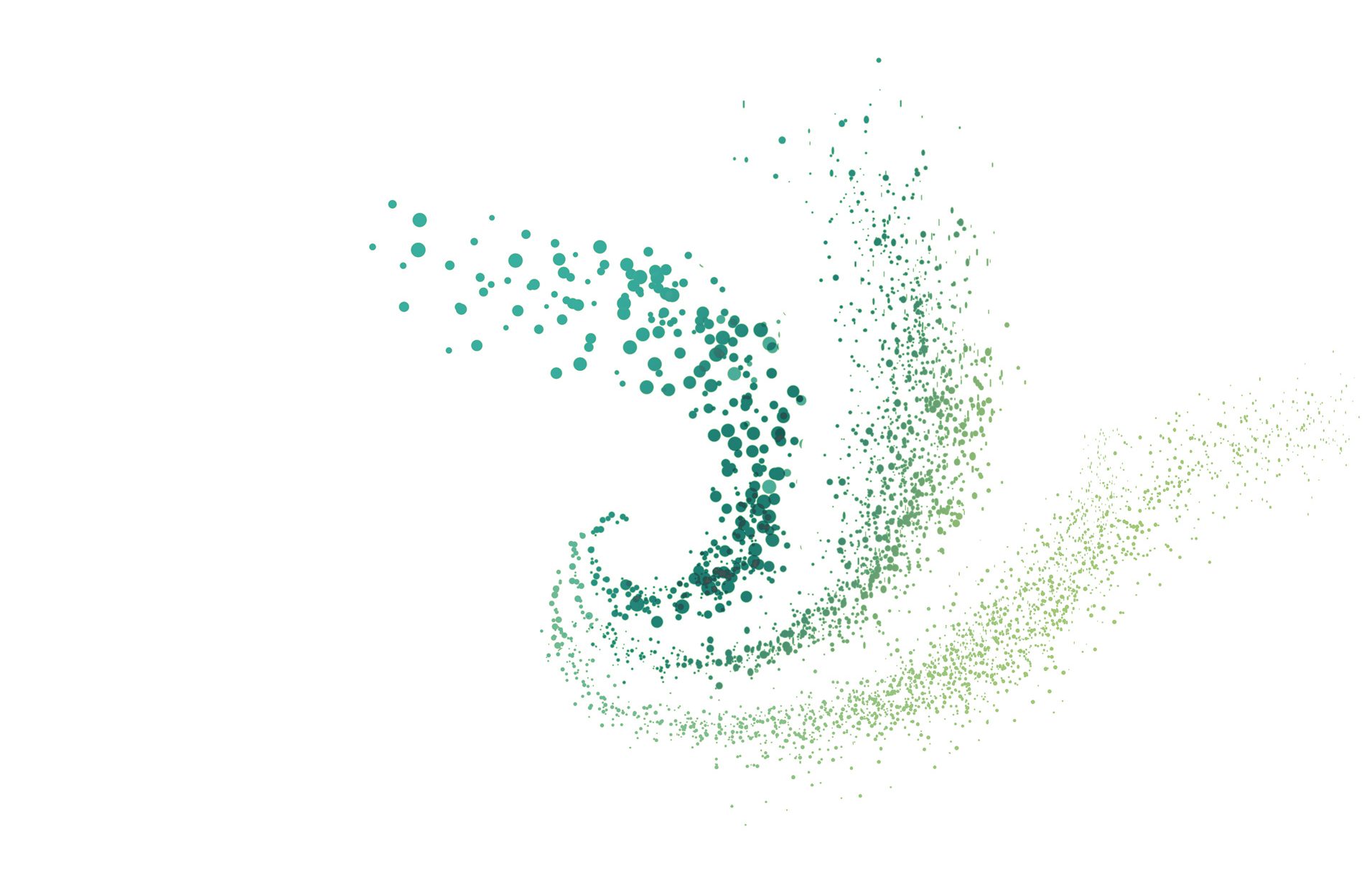
Ein Commons ist nicht einfach eine Gemeinschaft Gleichgesinnter oder eine Kohorte wohlmeinender Menschen, die sich erziehen lassen wollen, sondern, wir sagten das bereits, ein soziales System, das sich durch viele Akte des Beziehungsauf baus und der Diskussion entwickelt. Fast immer vertreten die daran Beteiligten alle möglichen Ideen, sie haben verschiedene Perspektiven und Motivationen, und sei es nur, weil sie unterschiedliche Persönlichkeiten und Hintergründe mitbringen. Wenn bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige geschickt realisiert wird, kann sie diese vielfältigen Sichtweisen zusammenbringen. Dafür gibt es im Grunde keinen Ersatz, denn andernfalls könnten sich die Menschen unbedacht auf irgendeine vorgestellte, eher abstrakte Zukunftsidee verpflichten, die ihren wirklichen Gefühlen und Bedürfnissen und den existierenden Möglichkeiten nicht entspricht. Dies ist eine zentrale Erkenntnis der indigenen und nicht-indigenen Organisationen, die zu Unitierra gehören, der Universidad de la Tierra en Oaxaca, Mexiko. Unitierra ist eine »de-institutionalisierte Universität« von Commoners für Commoners, die formale Rollen und Hierarchie ablehnt.[10] Aus Sicht der Gründerinnen und Gründer ist die Idee eines »gemeinsamen Zwecks« oder »gemeinsamer Ziele« wenig hilfreich; worauf es vielmehr ankommt, ist gemeinsames Handeln. In einem wirklichen Commons, sagt Gustavo Esteva, der intellektuelle Vater und Älteste von Unitierra, haben Menschen zwar oft gemeinsame Gründe, überhaupt zu handeln und das gemeinsam zu tun, aber das heißt nicht, dass sie einen gemeinsamen Zweck verfolgen und sich deswegen zusammentun. Bei Unitierra versuchen die Menschen, nicht auf die »Anziehungskraft der Zukunft«[12] zu setzen. Am Anfang steht nicht, Ziele zu klären oder zu fragen, wo sie hinwollen und wie sie sich vorstellen, dorthin zu kommen. Sie bemühen sich stattdessen, den »Schub aus dem Alltag und aus der Vergangenheit« zu nutzen, indem sie an die Erfahrungen und Motivationen aller anknüpfen.
Im und durch Commoning entsteht erst nach und nach eine gemeinsame Ausrichtung. Sie muss nicht notwendigerweise im Vorhinein augenfällig sein. Eine sogenannte intentionale Gemeinschaft mag von Anfang an gemeinsame Zwecke verfolgen und gemeinsame Werte haben, doch es gibt nicht sehr viele intentionale Gemeinschaften. Und Commons bedeutet nicht, dass sich alle in intentionalen Gemeinschaften organisieren. Meist findet ein bunter Haufen Menschen zusammen, sie gehen zunächst ein Stück miteinander, kommen gemeinsam in Bewegung und lehren sich mitunter gegenseitig das Tanzen. Dies wird leichter gelingen, wenn Menschen im selben Umfeld leben, auf denselben Fluss oder Wald angewiesen sind oder wenn sie dieselben Anliegen haben: die Erträge steigern, auf lokaler Ebene mehr Dinge gemeinsam nutzen oder Informationen frei verfügbar machen. All dies kann den Geist der Zusammenarbeit stärken. Doch man sollte – wie gesagt – in einem Commons nicht von einem anfänglichen »gemeinsamen Zweck« ausgehen. Ein solcher kann herauskristallisiert und sollte geklärt werden, wenn das kollektive Handeln auf Dauer effektiv sein soll. Der US-amerikanische Essayist und Dichter Henry David Thoreau hat diesen Prozess schön beschrieben: »Hast du Luftschlösser gebaut, so braucht deine Arbeit nicht verloren zu sein. Eben dort sollten sie sein. Jetzt lege das Fundament darunter!»[13] Obgleich dies vielen als weltfremder Idealismus erscheint, ist es doch eine treffende Beschreibung dafür, wie eine Vision sich entfaltet und dann verwirklicht wird: durch geduldige Arbeit und den Respekt für die Individualität aller Beteiligten, die daraus eine Ethik des Gemeinsamen entwickeln können. Diese Erkenntnis ist entscheidend, denn ein Commons braucht wie jedes Ökosystem eine »notwendige Vielfalt«, wenn es gut funktionieren soll. Auf Kontrolle bauende Systeme versuchen Regelkonformität durchzusetzen und Prozesse ständig zu verschlanken und zu optimieren, was Vielfalt reduziert. Commons sind eher in der Lage, verschiedenartige Störungen zu kompensieren und dadurch Resilienz zu beweisen, indem sie eine Vielfalt an Beteiligten und Perspektiven akzeptieren.
Wie entsteht bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige?
Es gibt viele Gründe, warum Menschen beginnen, ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen; und es gibt viele Wege, dies tatsächlich zu tun. Drei Pfade werden häufig eingeschlagen: spontane Anziehung, Tradition und bewusste Gestaltung.
Spontane Anziehung: Im Jahre 2009 trafen sich ein paar Freundinnen und Freunde in Kumpula, einem Stadtteil von Helsinki. Sie wollten besprechen, was sie tun konnten, um dem Klimawandel zu begegnen. Wie von der kollektiven Muse geküsst, beschlossen sie enthusiastisch, einen »Tauschkreis« zu gründen, um untereinander Gegenstände und Dienstleistungen auszutauschen – Altenpflege, Buchhaltung, Gartenarbeit, Schwimmunterricht usw. Die Idee fand schnell Anklang, und bis 2014 waren rund 3.000 Menschen dem Netzwerk beigetreten, das mittlerweile in »Zeitbank Helsinki« umbenannt wurde.[14] Dies mag die häufigste Art und Weise sein, wie ein Commons entsteht: Jemand identifiziert ein Problem oder bringt eine konstruktive Lösung ins Gespräch und stellt dann fest, dass viele Menschen, die über Ähnliches nachdenken oder ähnliche Probleme haben, sich davon angesprochen fühlen.
In digitalen Zusammenhängen wurden bereits legendäre Projekte auf diese Weise angestoßen. Kreative Menschen wollten etwas anders machen, gingen die ersten Schritte, haben Konventionen durchbrochen und dann andere eingeladen, sich zu beteiligen. 1991 entschied sich Linus Torvalds, ein 21-jähriger finnischer Informatikstudent, seine eigene Version des komplexen Betriebssystems Unix zu bauen (siehe S. 159). Er wollte, dass seine Version – anders als Unix – weitergegeben werden durfte. Innerhalb weniger Monate hatten sich Hunderte Hackerinnen und Hacker zusammengetan, um Linux mit zu entwickeln. Viele Beiträge kamen aus einem anderen Freie-Software-Projekt, GNU, welches Richard Stallman initiiert hatte. Innerhalb weniger Jahre waren Tausende Programmierfachleute daran beteiligt, ein erstklassiges Betriebssystem herzustellen, das heute mit Microsoft Windows und anderen proprietären Systemen nicht nur mithält, sondern sicherer und anpassungsfähiger ist. Eine ähnliche Geschichte lässt sich über Jimmy Wales erzählen, der gemeinhin als Vater der Wikipedia gilt. Er hatte die ersten Ideen, lud offen dazu ein mitzuwirken, und bald trugen Zehntausende dazu bei, eine vielsprachige Enzyklopädie zu »schreiben«, indem sie – ganz ohne finanzielle Anreize – Beiträge verfassten, ergänzten oder korrigierten. Heute gibt es über 300 Wikipedia-Versionen – von Albanisch über Tarantino (einem italienischen Dialekt) bis hin zu Waray (die fünfthäufigste Regionalsprache der Philippinen).
Tradition: Gemeinsame Ziele und Werte etablieren sich auch im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte durch alltägliche Praktiken. Im schweizerischen Wallis bauten die Bauern im 15. Jahrhundert bemerkenswerte Kanalnetzwerke, um Wasser aus den Bergen auf ihre Felder zu leiten.[15] Ähnliche Bewässerungssysteme – die Waale, Acequias, Faladji, Quanats oder Johad genannt werden – existieren auf der ganzen Welt. Sie alle beruhen auf traditionellen Formen gemeinsamer Wasserbewirtschaftung, in denen Regeln für die faire Zuteilung des kostbaren Nass an die einzelnen Bäuerinnen und Bauern von ihnen selbst entwickelt werden. Auf der südkoreanischen Insel Jeju hat sich seit dem 17. Jahrhundert eine Tauchkunst entwickelt, die vielen Mustern einer Commons-Ökonomie folgt. Es ist die Kunst der Seenfrauen, der Haenyeo. Sie sammeln die Meeresfrüchte ausschließlich per Hand und bedienen sich dabei lediglich eines Messers oder eines einfachen Eisenhakens. Und auch dies nur an 15 nach dem Mondkalender festgelegten Tagen sowie in Tauchgebieten, die sie fair unter sich aufgeteilt haben. Zu den Seefrauen gehörten 17 bis über 70jährige, doch die Kultur ist im Verschwinden begriffen. Dabei ließe sich viel von ihr lernen: Die Jeju Haenyeo tauchen nicht nur oft gemeinsam (aus Sicherheitsgründen), sie entscheiden auch gemeinsam über all ihre Belange. Sie sind weltweit bekannt geworden, weil sie durch körperliche Anpassung – etwa ein erweitertes Lungenvolumen – bis zu drei oder vier Minuten unter Wasser bleiben und bis zu 20 Meter tief tauchen können. Ohne Sauerstoffgerät. Dabei nutzen sie eine ähnliche Atemtechnik wie Wale und Robben.[16] Doch mindestens ebenso bemerkenswert ist, wie sie sich über Jahrhunderte organisiert und ihre Familien und Dörfer ernährt haben.[17] Die Kraft traditioneller Commons besteht darin, dass Bewirtschaftungsformen und kulturelle Praktiken entwickelt werden, die sehr genau auf die ökologischen Besonderheiten eines bestimmten Waldgebietes, Flusses, Fisch- oder Weidegrundes abgestimmt sind.
Bewusste Gestaltung: Wenn sich einander Fremde zusammentun, dann helfen mit Bedacht strukturierte Prozesse dabei, wirklich Gemeinsames entstehen zu lassen. Manche Commons werden gegründet, indem ein paar Aktive zunächst eine Charta verfassen, um ihre grundlegenden Ideen und Anliegen darzulegen. Mit diesem Statement animieren sie andere zum Mitmachen und zur Zusammenarbeit, das in der Charta Skizzierte auch umzusetzen. (In Kapitel 10 werden wir darauf zurückkommen und einige Beispiele vorstellen.) Pioniere wie Enspiral, die sich auf digitale Plattformen stützen, sind ebenfalls ein gutes Beispiel für bewusst gestaltete Selbstorganisationsprozesse. Enspiral ist ein Netzwerk von Sozialunternehmerinnen und -unternehmern mit Sitz in Neuseeland und hat unter anderem kollaborative Diskussions- und Entscheidungssoftware entwickelt, darunter Loomio sowie CoBudget. CoBudget macht es einfach, individuelle Projekte und Aktivitäten vorzuschlagen und gemeinsam über die Mittelzuweisungen aus dem Gesamtbudget zu entscheiden. Daran können sich nicht nur alle beteiligen, sondern die Entscheidungsprozesse und Mittelflüsse bleiben auch für alle einsehbar. Loomio stellt – in einem stufenweisen Prozess – eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, Ideen online einzubringen, zu diskutieren, zu verändern und schließlich anzunehmen oder abzulehnen. Commons auf technischen Plattformen zu gründen kann heikel sein. Viele scheinen zu glauben, dass man Governance-Probleme hinwegdesignen und dadurch Auseinandersetzungen über vertrackte Fragen zwischen realen Menschen vermeiden kann. Die Frage des Vertrauens etwa. Die Blockchain-Technologie beispielsweise wurde oft gepriesen, weil sie das Vertrauensproblem löse. Doch tatsächlich wird diese Frage nur in die Technologie verschoben und dann der Technologie – oft blind – vertraut. Vertrauen aufzubauen wird als nicht mehr notwendig erachtet. De facto ist die Blockchain institutionalisierte Vertrauenslosigkeit. Libertär gesinnte Gestalterinnen und Gestalter so manch digitaler Währung – allen voran Bitcoin – sind irrtümlicherweise der Ansicht, dass es dank der Technologie keiner unnötigen Governance mehr bedarf. Die Authentifizierung der digitalen Währung würde genügen, die libertäre Freiheit auf Plattformbasis zu entfalten.[18] Doch die erbitterten Streitigkeiten in Bitcoin-Kreisen um die Zukunft der Blockchain sprechen eine andere Sprache. Unausweichlich spielen reale Auseinandersetzungen um die Gestaltung von Prozessen, Organisationsformen und Technologien – genau wie die konkreten sozialen Praktiken – in jedem System eine wichtige Rolle, ungeachtet des bedeutenden Einflusses der Hard- und Software.

Commons brauchen Schutz, so sagen wir gern. Die Commons-Wissenschaft hat auf Basis ausgedehnter Feldforschungen immer wieder bestätigt, dass Grenzen notwendig sind. Das erste der acht Designprinzipien für erfolgreiche Commons lautet entsprechend: »klar definierte Grenzen«. Es benennt sowohl die Grenzen des Ressourcensystems, auf das sich Menschen gemeinsam beziehen, als auch die Frage, wer beteiligt (und nutzungsberechtigt) ist und wer nicht. Auch wir denken, dass Grenzen für die sorgsame Bewirtschaftung geteilten Vermögens unerlässlich sind. Doch zugleich müssen sie für die Energieflüsse und Anregungen aus der Außenwelt offen sein, denn so erhalten sie sich. Commoners müssen also irgendwie ihr gemeinsames Vermögen gegen Einhegungen schützen und sich zugleich aus der reichhaltigen Vielfalt des Lebens nähren. Dieses Kunststück gelingt, indem die Beteiligten Commons mit halbdurchlässigen Membranen umgeben, eine Strategie, die wir von anderen Organismen kennen. Sie sichert nicht nur das nackte Überleben, sondern trägt auch zum lebendigen Austausch bei. Wir beschreiben also die Qualität der notwendigen Grenzen als »halbdurchlässige Membran«. Schließlich geht es nicht darum, ein hermetisch abgeriegeltes System zu schaffen, das alle anderen ausschließt und Ressourcen ausschließlich für (zahlende) Mitglieder hortet. Dann wären Commons – in der Sprache der Ökonomen – »Klubgüter«. Es geht darum, Commons vor schädlichen Einflüssen zu schützen und zugleich für das offen zu halten, was ihnen zuträglich ist.
Halbdurchlässige Membranen unterscheiden sich von starren Grenzen dadurch, dass sie selektiv Durchlass erlauben, ähnlich wie wir auswählen, welche Lebensmittel wir essen und welche Beziehungen wir eingehen. Sie ermöglichen, dass ein Commons für all jene Nährstoffe offen bleibt, die »dem Ganzen nutzen«, denn Leben entsteht, wenn es ausreichende Energieflüsse gibt. Dies ist zentral für die Wertsouveränität von Commons. Während in der Logik des Kapitalismus Vermögenswerte angehäuft und konzentriert werden, setzen Commoners auf halbdurchlässige Membranen als Werkzeuge für einen lebendigen Austausch mit dem Außen. Anstatt sich also Commons als geschlossenes Gemeineigentum vorzustellen, das von Klubmitgliedern bewirtschaftet wird, sollten wir sie als soziale Organismen betrachten. Dank ihrer halbdurchlässigen Membrane können sie geschützt bleiben und doch mit anderen, größeren Kräften interagieren – mit Ökosystemen und anderen Commons oder Institutionen.
Dies ähnelt der Funktionsweise der Blut-Hirn-Schranke in unserem Gehirn. Sie trennt das Blut, welches in unserem Körper zirkuliert vom Gehirnwasser im zentralen Nervensystem. Wasser, einige Gase und fettlösliche Moleküle sowie Glukose und Aminosäuren, die für die neurale Funktion unerlässlich sind, werden zum Gehirn durchgelassen. Aber – und dies ist entscheidend – potenzielle Neurotoxine können nicht eindringen. Commons benötigen eine ähnlich effektive Membran, um durchzulassen, was zuträglich ist, und herauszufiltern, was schaden könnte. Vielleicht ist Geld samt seiner Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen – wer profitiert davon?, wofür wird es eingesetzt?, welche Beziehungen könnten verzerrt werden? – das potenziell problematischste »Neurotoxin« für ein Commons (siehe Commons & Kommerz auseinanderhalten, S. 143). Wenn man in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt, ist es oft unmöglich, sich der Macht des Geldes zu entziehen, wieder mehr Lebensbereiche nicht »als Handelsware« zu organisieren und sich aus Marktbeziehungen zurückzuziehen. Aber eine halbdurchlässige Membran, die ein Commons umgibt, kann zumindest verhindern, dass selbige einmal geschaffene oder noch existierende marktfreie Räume vereinnahmen und zerstören. Commoners müssen daher halbdurchlässige Membranen schaffen, um Commons samt ihrer nicht kommodifizierten Vermögenswerte zu schützen. Am besten möglichst wartungsarm.
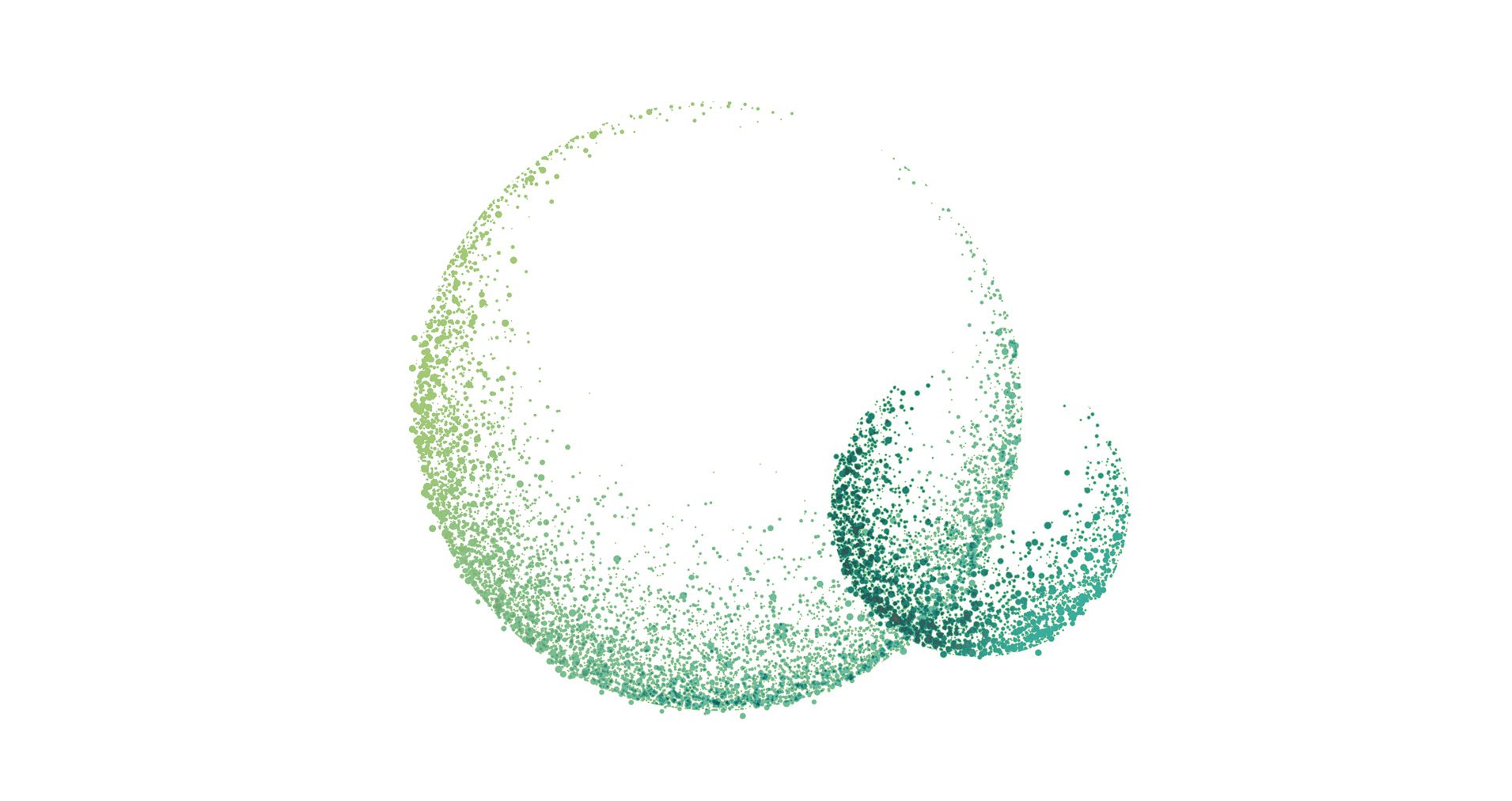
Man könnte sagen, dass es zwei verschiedene Formen von Transparenz gibt: rechtliche Transparenz, wie liberale Demokratien sie für ihre Rechenschaftslegungen benötigen, und tatsächliche Transparenz, die es nur dann geben kann, wenn Menschen einander kennen und vertrauen. Der Unterschied ist alles andere als trivial. Nehmen wir eine verteidigungspolitische Frage. Wenn während eines Kampfeinsatzes eine schwierige Entscheidung ansteht oder der General einen Befehl erteilt, den untergeordnete Offiziere für problematisch halten – wem sollen die Soldaten gehorchen: dem offiziellen Vorgesetzten in der Kommandostruktur oder den anderen Offizieren, die man kennt und denen man vertraut? In der Logik von Politik, Bürokratie und Verwaltung ist Transparenz mitunter eher eine formale Scharade als ein Mitteilen aus tiefer Überzeugung. Das liegt auch daran, dass alles, was offengelegt wird, gegen einen selbst verwendet werden kann und auch wird. Politik ist als Wettbewerb konzipiert. Die Norm ist daher die geringstmögliche Preisgabe von Informationen. Tatsächliche Transparenz erfordert mehr als die offizielle Rechenschaftspflicht aufgrund von Rangordnungen und Protokollen einzuhalten – sich also bürokratisch abzusichern. Es bedeutet auch, sich persönlich mitzuteilen und das eigene Empfinden authentisch offenzulegen. Diese Art der Transparenz ist so wichtig, weil sie die Fassade der formalen Rollen und Regeln auf brechen kann. Und sie ist ein Grund dafür, warum Commoning nicht nur herausfordernd ist, sondern uns auch selbst tiefgreifend verändert. Dem Ökonomen und klinischen Therapeuten Stefan Brunnhuber zufolge ist kulturelle Transformation mit rational-diskursiven Ansätzen allein weder zu verstehen noch zu erreichen. »Der Versuch der Komplexitätsreduktion, etwa durch mehr Transparenz oder eine Vereinfachung von Abläufen, ... hilft [wenig]«, schreibt er. Benötigt werde »psychologisch eine andere Strategie«.[19] Wir müssen beginnen, uns die Wahrheit zu sagen, und dafür bietet Commoning eine adäquate Umgebung. Sie erlaubt uns, damit umzugehen, dass Transparenz nicht einfach »organisiert« werden kann, sondern gespürt werden muss. Wir können Angelegenheiten, die unsere Kultur und unser Inneres berühren, nicht dadurch gerecht werden, dass wir die »richtige Organisationsform« finden und darin viele Informationen offenlegen, auch wenn das wichtig ist. Aber »Komplexität müssen wir [zudem] emotional aushalten können«.[20] Das gilt auch für die Komplexität des Commoning. Diese Erkenntnis rückt den fortdauernden Dialog, der zwischen Organisationsstruktur und -kultur nötig ist, in ein neues Licht. Schon Elinor Ostrom wies darauf hin, dass »Reputation und gemeinsame Normen an sich nicht ausreichen, um auf die Dauer ein stabiles kooperatives Verhalten zu erzeugen«.[21] Bei Transparenz geht es entsprechend nicht nur um geeignete Strukturen und Verfahren, sondern vor allem darum, all das zu praktizieren, was Vertrauen stärkt und stiftet.
Cecosesola in Venezuela pflegt eine solche Kultur tiefen Vertrauens: Die Menschen vertrauen darauf, dass sie einander grundsätzlich und vorbehaltlos anerkennen und dass sie einander auf Augenhöhe begegnen. Cecosesoler@s sind daher bereit, scharfe Kritik zu äußern und sich anzuhören, während sie gleichzeitig Respekt für einander zeigen (siehe S. 109). Cecosesola hat die Bedingungen für eine Kultur des Vertrauens geschaffen – wie wir in diesem Buch an verschiedenen Stellen darstellen. Es geht nicht einfach um tatsächliche Transparenz, es geht darum im Vertrauensraum transparent zu sein. Das ist für gelingendes Commoning unabdingbar. Eine Umgebung, die Vertrauen ermöglicht, ist die einzige Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen, verlässliche Informationen – auch unangenehme – einzubringen und gleichzeitig stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ein lebendiges Commons braucht tatsächlich mehr als gute Einfälle und Professionalität. Es hängt auch von ehrlichen (Selbst-)Einschätzungen und der Weisheit der Beteiligten ab, damit umzugehen. Immer und immer wieder – denn Beziehungen, die auf Vertrauen beruhen, benötigen dauerhaft Beachtung. Sie müssen ständig erneuert und gepflegt werden.
Natürlich gibt es in den meisten Gruppen oder Netzwerken auch Intrigen, eigennütziges Verhalten oder Cliquenbildung, die es schwer oder unmöglich machen, einen Vertrauensraum zu schaffen, geschweige denn, tatsächlich offen zu sein. Auch die Größe (beziehungsweise Kleinheit) einer Gruppe ist für sich genommen keine Garantie für Vertrauen oder Transparenz. Aber in Kombination mit anderen Mustern der Peer Governance – etwa Wissen grosszügig weitergeben sowie auf Heterarchie bauen – kann Commoning stabil erfolgreich sein.
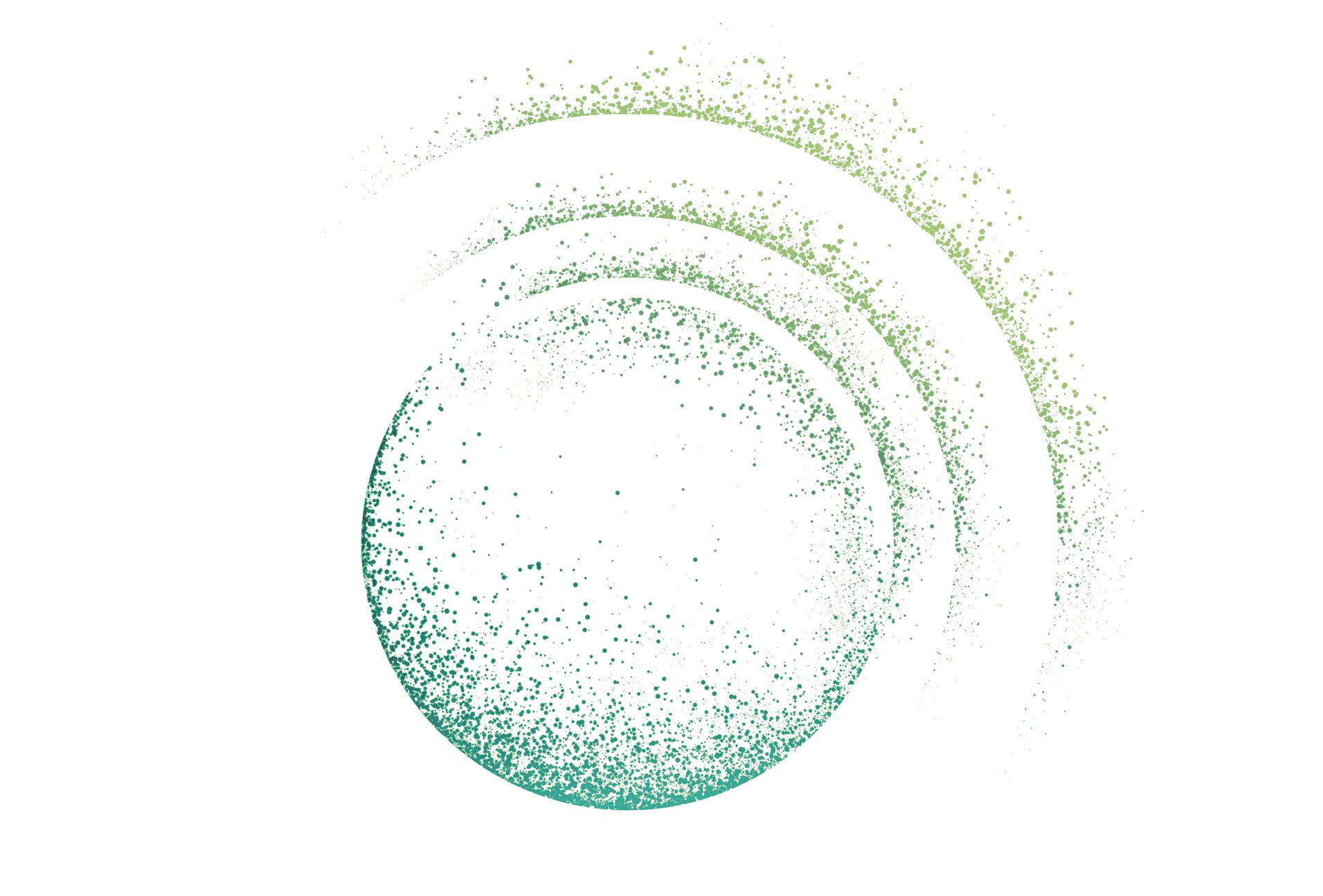
In allen Commons wird Wissen (bzw. seine verdinglichte Cousine, die Information) weitergegeben. Das ist nicht einfach »nett«. Es ist ein Schlüsselinstrument, mit dem Menschen ihre eigene Sozialordnung schaffen. Es ist das wichtigste Muster, nach dem Online-Gemeinschaften Freie und Open-Source-Software (FOSS) entwickeln. Dem Kulturhistoriker dieser Kultur, Christopher Kelty, zufolge sollten wir die naive Vorstellung überwinden, dass die Weitergabe von Wissen »ein natürlicher Zustand des menschlichen Lebens ist«. Vielmehr, so schreibt er, ist die Geschichte weitaus interessanter: »Die Weitergabe [von Wissen] schafft ihre eigene Art moralischer und technischer Ordnung, das heißt: ›Information bringt die Menschen dazu, Freiheit zu wollen‹, und wie sie dies wollen, hängt damit zusammen, wie diese Information geschaffen und verbreitet wird.«[22]
Frühe Projekte zur Entwicklung gemeinsamer Code-Bestände, etwa das UNIX-Betriebssystem, aus dem schließlich Linux hervorging, zeigen, dass die Konzentration auf die Ressource – wie in der Wirtschaftswissenschaft üblich – zur Folge hat, dass die wesentlichere Geschichte übersehen wird: komplexe soziale Systeme entstehen nach und nach, indem Informationen weitergegeben werden. Es geht weniger um den Code, als vielmehr um die Philosophie dahinter. Tatsächlich sprechen Geeks von der UNIX-Philosophie[23]. Dass sie dies tun, bedeutet, so Kelty, »dass UNIX nicht nur ein Betriebssystem ist, sondern eine Art und Weise, die komplexen Lebens- und Arbeitsbeziehungen mit technischen Mitteln zu organisieren; eine Möglichkeit, die Grenzen zwischen dem Akademischen, dem Ästhetischen und dem Kommerziellen zu kartieren und zu durchbrechen; eine Möglichkeit, Ideen einer moralischen und technischen Ordnung umzusetzen«.[24] UNIX und Linux sind aus einer schöpferischen Beziehungsökonomie heraus entstanden.
Ausgehend von diesem Modus – Wissen weiterzugeben (engl. knowledge-sharing) – lässt sich eine allgemeine Erkenntnis formulieren: Die spezifischen Kreise, die weitergegebenes Wissen in einem Commons zieht, bestimmen den Charakter dieses Commons mit. Dabei kommt es auf verschiedene Aspekte an: auf die unterschiedlichen Quellen von Wissen und Können, auf die Frage, nach welchen Kriterien wir diese Quellen anerkennen, und auf die Arten und Weisen, wie Menschen explizites und implizites Wissen aufnehmen und einsetzen, was in verschiedenen Commons auch verschieden sein wird.
Die bekannteste und einfachste Form, Wissen weiterzugeben, ist sicherlich die Besprechung – Neudeutsch: meeting. Mitglieder- oder Vollversammlungen sind im Prinzip nichts Anderes. Wir haben gesehen, wie Cecosesola die Form und Funktion von Besprechungen gewissermaßen neu erfunden hat. Es sind weitgehend formlose, aber aufmerksame und häufige Treffen, die nicht die Arbeit unterbrechen, sondern sie ausmachen und die sowohl Gelegenheit bieten, soziale Verbundenheit zu pflegen als auch Wissen und Informationen weiterzugeben. Wie auch immer Besprechungen dimensioniert und strukturiert sind: Sie alle haben den Zweck, Erkenntnisse mühelos weiterzugeben und so zu streuen, dass die Beteiligten informierte kollektive Entscheidungen herausfiltern und treffen können – etwa über zeitweilige Einschränkungen der Ressourcennutzung oder über die Aufteilung dessen, was erarbeitet wurde.
In vielen Commons werden Informationen stigmergisch zusammengetragen und weitergegeben. Es handelt sich um eine Art situierter Informationsvermittlung, die immer auch einen »Stimulus und eine Anweisung für die weitere Arbeit enthält.[25] Die griechischen Wurzeln des Wortes »Stigmergie« bedeuten »zur Arbeit ermuntern«. Stellen Sie sich Ameisen auf Nahrungssuche vor. Sie markieren ihre Pfade mit Pheromonen – d.h., sie hinterlassen eine Spur, ein Informationssignal. Winzig, aber ausreichend, sodass andere Ameisen den mit Pheromonen markierten Pfaden folgen, den nächsten Arbeitsschritt gehen und Nahrung finden können. Auf diese Weise können sehr spezifische, individuelle Informationen unkompliziert weitergegeben werden, was zeitig zu Reaktionen führen kann und die verteilte Selbstorganisation ermöglicht, und zwar ohne dass eine zentrale Koordination nötig wird. Termiten benutzen stigmergisches Lernen und stigmergische Koordinierung, um ihre komplexen Nester zu bauen – ohne Chefdesigner oder Aufsichtskräfte. Die einzelnen Termiten geben Informationen weiter und die, die sie erhalten, passen ihr Verhalten unmittelbar an. Die Koordination findet horizontal, asynchron und unregelmäßig statt. Das Beispiel zeigt, wie einfache Vorgänge oder Regeln in verteilten Systemen eine formidable kollektive Intelligenz hervorbringen können.
Stigmergie ist also ein Weg, Informationen indirekt weiterzugeben und das Handeln auch dann ohne zentrale »Behörde« zu koordinieren, wenn alle Beteiligten voneinander räumlich getrennt sind. Die bekannten roten Links in vielen Wikipedia-Einträgen – auf die man klickt, nur um dann zu lesen, dass über das Thema noch nichts geschrieben worden ist – sind eine solche stigmergische Information. Sie signalisieren, dass weitere Informationen gebraucht werden und laden dadurch ein, das Fehlende beizutragen. Ein einfaches Signal (der rote Link) regt zu stigmergischer Koordination in wahrhaft gewaltigem Maßstab an, was zu einem komplexen Konvolut digital erfasster Schriftbeiträge führt: dem Wikipedia-Pluriversum.
Ein weiteres Beispiel ist die Freiwilligenkoordination für das Humanitarian OpenStreetMap Team. Nach Naturkatastrophen wie dem Erdbeben in Haiti 2010 arbeiten Freiwillige mit Hochdruck daran, sehr detaillierte, freie Online-Karten zu erstellen. Sie sind für Ersthelfende wichtig, die Wasser, Nahrungsmittel und medizinische Versorgung auftreiben müssen.[26] Wenn jemand eine wertvolle Information erhält und die Karte ergänzt, wird dies gleich an andere weitergegeben. Das wiederum kann eine Kaskade von Verbesserungen auslösen. Menschen, die überall in der Welt verstreut sind und viele unterschiedliche Talente haben, erstellen so in kurzer Zeit eine digitale (Katastrophen-)Landkarte, die häufig genauer ist und schneller vorliegt als Karten, die von professionellen Teams produziert werden.
Wer sich auf Augenhöhe organisieren will, muss sicherstellen, dass Informationen und Wissen oft und großzügig weitergegeben werden; und dass sie mit minimalem Widerstand durch das Netzwerk fließen können. So ziehen sie Kreise, die im Laufe der Zeit das Entstehen einer commons-basierten Sozialordnung vorantreiben.
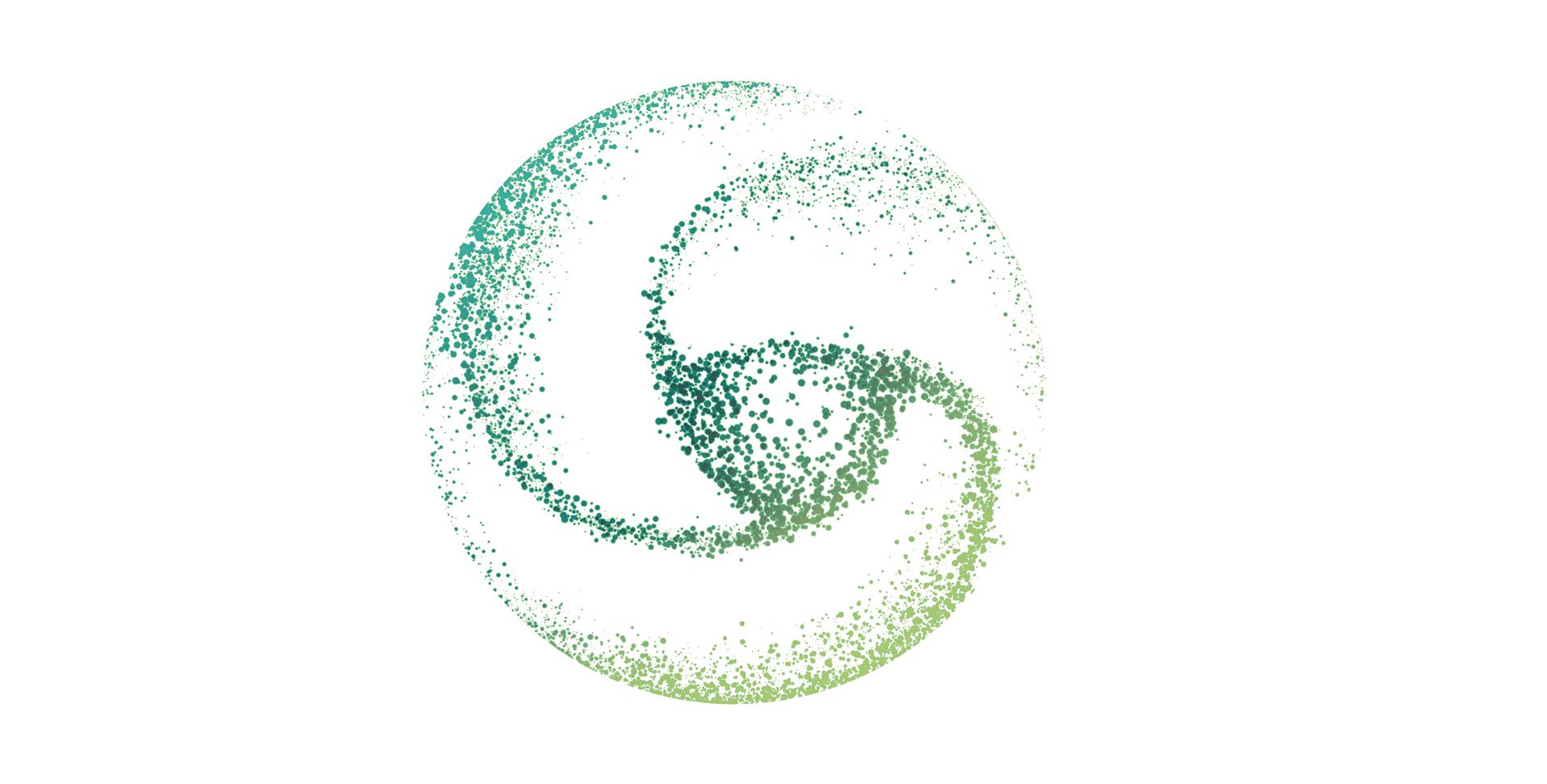
Es ist elementar – fast ein Gemeinplatz –, dass Commoners bei der Entwicklung der Regeln, die für sie gelten, tatsächlich mitreden können. Wie so oft gibt es auch hier viele Möglichkeiten. Die direkte Beteiligung kann unterschiedlich intensiv sein, zumindest aber müssen Commoners ihre Ansichten per Peer Governance äußern und den getroffenen Entscheidungen zustimmen können. Dieser Gedanke ist dem dritten Designprinzip nach Elinor Ostrom ähnlich: »Die meisten Personen, die von operativen Regeln betroffen sind, können über Änderungen der operativen Regeln mitbestimmen.«[27]
In kleinen Gemeinschaften bieten Besprechungen, bei denen alle im Kreis sitzen, einen Rahmen für die Entscheidungsfindung. So etwa in den indischen Panchayat (Dorfräten), wo über die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Gemeinschaftswäldern oder Ackerland beraten wird. In manchen Commons übernehmen Führungsgremien oder andere Instanzen Koordinationsaufgaben, was zu weniger direkter Beteiligung führt. Es gibt Vorstandsgremien von wissenschaftlichen Open-Access-Zeitschriften und -Archiven[28], in der Verwaltung von Zeitbanken, in Projekten der Solidarischen Landwirtschaft oder in den Stiftungen, die verschiedene Open-Source-Softwareprojekte tragen. Doch auch wenn es irgendeine Form zentralen Managements gibt, werden im Allgemeinen diejenigen konsultiert, die von den Entscheidungen betroffen sind. Die Beteiligten werden nicht »beliefert« wie in einer Dienstleistungsbeziehung, und ihre Anliegen werden nicht »verwaltet« wie in einer Behörde, sondern sie werden aufgenommen und einbezogen.
Eine Möglichkeit, dies ohne zu viel Diskussion zu tun, ist, Traditionen zu etablieren und zu pflegen. An Gebräuchen und Traditionen teilzunehmen, die nicht notwendigerweise progressiv sein müssen, kommt einer Art »umfassender Zustimmung« gleich. Zudem kann auf diese Weise eine bestimmte Kultur in die Regeln der Selbstorganisation eingebaut werden. Zum Beispiel nehmen Bäuerinnen und Bauern auf Bali die komplexen Probleme von Insektenbefall und Wasserknappheit in Angriff, indem sie an bestimmten Tagen religiöse Rituale vollziehen. Diese prägen auch die Regeln der Bewässerungsgemeinschaften, die auf Bali Subak genannt werden.[29] Die Bäuerinnen und Bauern pflanzen den Reis zu unterschiedlichen Zeitpunkten, was dazu beiträgt, Wasserknappheit abzuwenden; aber sie ernten den Reis zum selben Zeitpunkt, um die Ausbreitung von Schädlingen zu minimieren. Soziale und religiöse Praktiken mit ökologischen Abläufen in Einklang zu bringen funktioniert auch als kollektives Zustimmungs- und Koordinierungssystem.[30] Was aus westlicher Sicht wie religiöser Konservatismus erscheinen mag, erweist sich tatsächlich als elegante Lösung sozioökologischer Probleme.
Im eben beschriebenen Beispiel scheint es so, als würden Entscheidungen nicht wirklich getroffen. Was wie getan wird, das ist vielmehr Ergebnis eines Prozesses, der tief in der Kultur verankert ist. Oft aber ist nicht tradiert, was zu tun ist. Es ergibt sich auch nicht einfach so, sondern muss bewusst entschieden werden. Irgendwann enden die Besprechungen und Abwägungen, und im Moment der Entscheidung ist eine Wahl zu treffen. Dann ist nicht nur der Verlauf des Entscheidungsprozesses wichtig, sondern auch das Kriterium, auf dessen Grundlage entschieden wird. Häufig wird angenommen, dass in Commons immer konsensual entschieden wird. Dabei wird Konsens nicht selten verkürzt auf die Vorstellung, dass sich alle über alles einig sein müssen. Soviel Harmonie ist selten! Uneinigkeit ist eine Realität der menschlichen Existenz. Und selbst wenn Konsens angestrebt wird, was in kleinen Gruppen häufig der Fall ist, handelt es sich dabei nicht um dasselbe wie Einstimmigkeit. Die Beteiligten können verschiedene Regeln anwenden: »Einstimmigkeit minus eins« oder »Einstimmigkeit minus zwei« (d.h., eine Entscheidung zu treffen, obwohl eine bzw. zwei Personen nicht zustimmen). Natürlich sind solche Verfahren nicht auf kleine Gruppen beschränkt.
In jedem Commons – egal welcher Größe – sind die Chancen auf den Erfolg gemeinstimmiger Entscheidungen größer, wenn auf das Schema »Gewinnen oder Verlieren« verzichtet wird. Das ist der große strukturelle Fehler von Mehrheitsentscheidungen, wie wir sie aus demokratischen Abstimmungen kennen: Das Kriterium »die Mehrheit gewinnt« bedeutet im Allgemeinen, dass sich etwas mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten gegen die Anderen durchsetzen. Wer zu den 49,99 Prozent gehört, hat Pech. Kein Wunder, dass es für repräsentative Demokratien, die auf solchen Entscheidungskriterien auf bauen, schwierig ist, tiefe Spaltungen zu heilen oder die Mitwirkung der überstimmten Minderheit zu sichern. Kein Wunder, dass Ideologien entstehen, mit denen die Unterschiede zwischen Parteien geschärft werden sollen – anstatt nach Verbindendem zu suchen. Das folgt geradezu zwangsläufig aus einer wettbewerbsartigen Konzeption von Entscheidungsprozessen nach dem Schema »Gewinnen oder Verlieren«. Die Problematik existiert im Grunde auch bei Entscheidungen nach dem Kriterium der »relativen Mehrheit«, in denen gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält, auch wenn keine absolute Mehrheit erreicht wird. Wie kann man dieses Schema »Gewinnen oder Verlieren«, »Sieg oder Niederlage« vermeiden? Wie kann sichergestellt werden, dass alle Beteiligten einen bestimmten Weg mitgehen, ohne sich gezwungen, genötigt oder betrogen zu fühlen? Oder genauer gefragt: Wie kann die Entscheidungsfindung so gestaltet werden, dass sie nicht erst Frustrationen erzeugt – und dann unterdrückt; Frustrationen, die sich ihren Weg in alle möglichen Aggressionen bahnen.
Entscheidend ist, dass jeder Entscheidungsprozess die offene Diskussion fördert. Alle sollten sich ermutigt fühlen zu äußern, was sie bewegt. Sie sollten sich sicher sein können, dass auch tiefere Bedenken gehört werden. Dafür gibt es viele Methoden. Das Quäker-basierte Modell oder die inzwischen berühmten Handzeichen, die die Occupy-Protestierenden bei ihren Aushandlungen intern benutzten und die heute vielerorts Anwendung finden.
Das Quäker-Kontinuum
Das sogenannte »Quäker-Kontinuum« beinhaltet sechs verschiedene Positionen, die Menschen zu einer Entscheidungsfrage einnehmen können: von voller Unterstützung bis zur totalen Ablehnung, Interessenunterschiede werden transparent und können offen miteinander verhandelt werden. Gut sichtbar wird das durch Aufstellung im Raum (oder graphische Visualisierung auf dem Bildschirm). Sind die Positionen eingenommen bieten sich Einzelverhandlungen zwischen Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher, gegensätzlicher oder ähnlicher Standpunkte an. Gibt man einer zweiten Stellübung Raum, so wird ablesbar, ob sich etwas geändert hat. Sind die vorherigen Antagonismen bestehen geblieben, muss eine Entscheidung aufgeschoben werden. Ein Moratorium ist angesagt. Durch die Sichtbarmachung von Positionen wird auch ablesbar, mit wie viel Energie eine eventuelle Entscheidung von dem Gremium getragen wird.
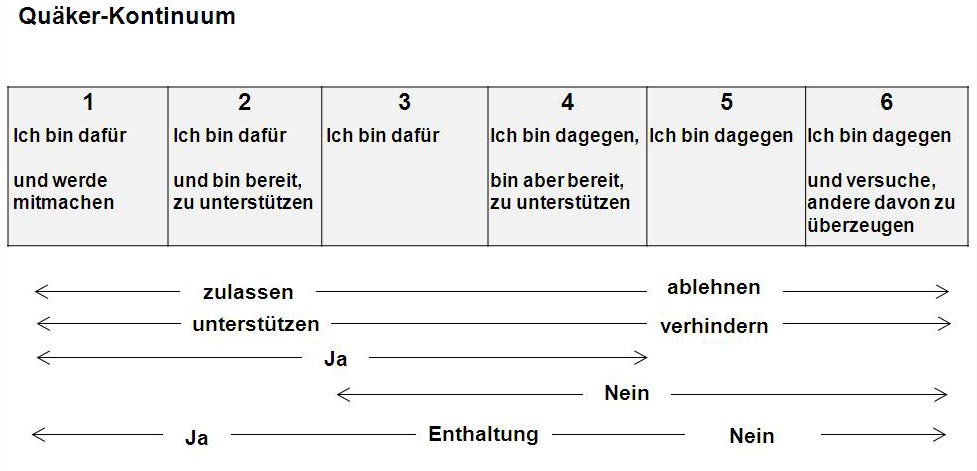
Quelle: Bedingungen und Methoden guter Entscheidungsfindung, Vgl.: www.futur2.org/article/bedingungen-und-methoden-guter-entscheidungsfindung/
Wichtig ist, dass an allen Methoden, die gemeinsame Entwicklung von Vorschlägen und Ideen erlauben, weitergearbeitet werden kann. Heute erlauben es die Allgegenwart des Internets und sehr leistungsfähige Software zum ersten Mal in der Geschichte, auch in sehr großen Zusammenhängen gemeinstimmig zu entscheiden. Also auch, wenn Menschen überall in der Welt verstreut sind und einander nicht kennen. Digitale Plattformen ermöglichen es, Diskussionsprozesse zu strukturieren, wobei zeitversetzt (asynchron) kommuniziert werden kann und gestufte Verfahren für die Moderation, Diskussion und Abstimmung zum Einsatz kommen. Eines der wichtigsten Werkzeuge für gemeinstimmige Entscheidungsprozesse ist – wir haben es schon vorgestellt – Loomio.
Die Entwicklerinnen und Entwickler von Loomio – aus der Kooperative Enspiral mit Sitz in Neuseeland – wollten einen Prozess abbilden, in dem Menschen sich beraten und dadurch allmählich zu einem tragfähigen Ergebnis kommen. Weil meinungs- oder lautstarke Gruppen tendenziell andere Perspektiven an den Rand drängen und kollektive Entscheidungsprozesse dominieren, bietet Loomio zahlreiche Möglichkeiten, alternative und ablehnende Meinungen zu äußern. Richard Bartlett schreibt: »Der Mehrwert von Loomio ist, dass Diskussion und Schlussfolgerung [auf dem Bildschirm] nebeneinander erscheinen. Eine Tortengrafik veranschaulicht die Uneinigkeit, und zwar so, dass ihr Beachtung geschenkt werden muss. Das hilft, Unstimmigkeiten aufzulösen. Im Unterschied zu einfachen Abstimmungen und anderen Wahlverfahren kann man hier während der Diskussion über einen Vorschlag die eigene Meinung ändern. Es ist fast wie ein Spiel, in dem die Beteiligten die Bedenken durcharbeiten müssen und dadurch die Entscheidung verändern.«[31]
Loomio sieht in einem solchen Prozess nicht vor, dass gleichzeitig mehrere Vorschläge erwogen werden können. Die Grundidee ist eine andere. Die Beteiligten sind im Verlauf einer Diskussion ab einem bestimmten Moment gezwungen, einem einzigen Vorschlag samt aller vorgebrachten Bedenken uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu schenken. Dass die Plattform irgendwann die gleichzeitige Beratung über andere Vorschläge unmöglich macht, könnte als einschränkend kritisiert werden. Aber das minimalistische und dennoch anpassbare Design des Online-Werkzeugs zur Diskussion und Entscheidungsfindung ermöglicht auch andere Entscheidungsverfahren. So kann eine Gruppe, eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk selbst entscheiden, wie sie beraten und entscheiden will – auch eine Mehrheitsentscheidung ist möglich. Zugleich werden die vorgebrachten Argumente immer dokumentiert.
Es gibt, zweifellos, keine einzige »beste« Art und Weise der Entscheidungsfindung. Die Auswahl der Verfahren, Kriterien und Instrumente – in ihrer Kombination – muss immer zum konkreten Kontext passen. Das ist der entscheidende Punkt. Allerdings helfen zwei grundlegende Unterscheidungen in der Gestaltung des gemeinstimmigen Entscheidens. Die erste ist die Unterscheidung zwischen Einverständnis (Konsens) und Zustimmung (Konsent). Die zweite ist die Unterscheidung zwischen gemeinsamen Kriterien und Abstimmungen.
Wenn ich einem Vorschlag zustimme, dann bedeutet das nicht notwendigerweise, dass er meine erste Wahl ist oder dass ich mit dem Vorschlag ganz übereinstimme. Es kann sein, dass ich einfach den Prozess unterstütze und nicht im Weg stehen will. Vielleicht habe ich auch keinen besseren Vorschlag. Oder ich hoffe, dass die anderen beim nächsten Mal so wenig auf ihre persönlichen Präferenzen bestehen, wie ich das dieses Mal tue. Manchmal entscheiden sich Commoners dazu, Hürden aus dem Weg zu räumen, indem sie es leichter machen zuzustimmen. Das spiegelt sich in folgender Frage: »Kannst du mit diesem Vorschlag leben?« Solch ein Ansatz kann helfen, dass alle zustimmen, ohne dass sie vollumfänglich einverstanden sind (siehe Kasten).
Konsent statt Konsens: Das Beispiel Soziokratie
Zustimmung ist – im Gegensatz zum Einverständnis – durch das Fehlen vernünftiger Einwände definiert. Die Grundannahme ist, dass Menschen meistens gute Gründe haben, mit einer Sache nicht einverstanden zu sein. Es muss daher nicht nur einen Raum und die Möglichkeit geben, diese Gründe darzulegen. Sie sollten auch die Qualität der zur Auswahl stehenden Lösungen beeinflussen. Mit anderen Worten: in Konsent-Verfahren wird gezielt nach Einwänden gesucht, um all jene Ideen und Vorschläge sichtbar zu machen, die eine Vereinbarung verbessern könnten. Es wird also nicht der Vorschlag ausgewählt, dem die meisten zustimmen, sondern jener, gegen den es die wenigsten oder am wenigsten schwerwiegenden Einwendungen gibt. Die Logik dahinter? Je weniger Widerstand, desto mehr langfristige Akzeptanz. Eines der bemerkenswertesten Systeme der Koordination und Entscheidungsfindung unter Gleichrangigen nach dem Konsentprinzip ist die Soziokratie.
James Priest, Mitbegründer von Sociocracy 3.0, schreibt dazu: »Im Konsens geht es darum, die beste Entscheidung für einen bestimmten Zweck zu finden. Im Konsent-Verfahren geht es darum, zu einer Entscheidung zu kommen, die gut genug ist, im Laufe der Zeit ausprobiert, getestet und verbessert zu werden.« Dieser einfache Gedanke kann durchaus als eine der tragenden Säulen bewusster Selbstorganisation gelten.
Auch soziokratische Koordination geht davon aus, dass Menschen oft gute Gründe haben, mit einem Vorschlag oder einem Vorgehen nicht einverstanden zu sein, dass es aber schwierig und zeitaufwändig sein kann, sich vollständig zu einigen. Hinzu kommt: Viele lehnen kollektive Entscheidungsfindungen ab, weil sie zu oft besserwisserische Diskussionen erlebt haben, in denen sich durchsetzt, wer argumentationsstark ist, während andere wichtige Standpunkte ungehört bleiben.
Soziokratie begegnet diesem Problem dadurch, dass Kreise gebildet werden. Jedem Kreis entspricht ein bestimmter Verantwortungsbereich. Wer zu einem Kreis gehört und dort mitdiskutiert, hat auch Entscheidungsbefugnisse über diesen Verantwortungsbereich.
»In der Soziokratie ist es Standard, sich in Kreisen zu besprechen«, erklären Jerry Koch-Gonzalez und Ted J. Rau von Sociocracy for All. »Jeder hat die Chance zu reden, eine nach der anderen. Das bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass auch Sie beitragen können und gehört werden. Niemand kann ignoriert werden. Langfristig gesehen, spart das Zeit!« Jemand macht einen Vorschlag und die anderen kommentieren ununterbrochen die vorgebrachten Ideen. Wenn es Einwände gibt, was unvermeidlich ist, sind alle aufgefordert, die auf dem Tisch liegenden Vorschläge durch kontinuierliches Feedback zu verbessern. Dies führt schließlich zu Lösungen, denen fast alle zustimmen können.
Die soziokratische Methode wird in Schulen, Wohngruppen, Genossenschaften und vielen anderen Bereichen eingesetzt. Dabei muss sie sich nicht auf kleine Gruppen beschränken. Zwar treffen in der Regel überschaubare Teams ihre Entscheidungen in »ihrem Kreis«, aber diese Kreise sind normalerweise mit einem größeren »Elternkreis« verknüpft beziehungsweise in diesen eingebettet, der größere Entscheidungsbereiche überblickt. Tatsächlich ist jeder Kreis doppelt verknüpft. Das heißt, zwei Kreismitglieder sind gleichzeitig Vollmitglieder sowohl des kleineren Teams als auch des Elternkreises. Dies hilft, die Macht so weit wie möglich auf die untersten Ebenen (»Subsidiarität«) zu verteilen und die Arbeit verschiedener Kreise zu koordinieren. So wird sichergestellt, dass sich jedes Team auf das konzentrieren kann, was ihm wichtig ist, und gleichzeitig ist damit sichergestellt, dass wichtige Informationen mit allen geteilt und umgesetzt werden.
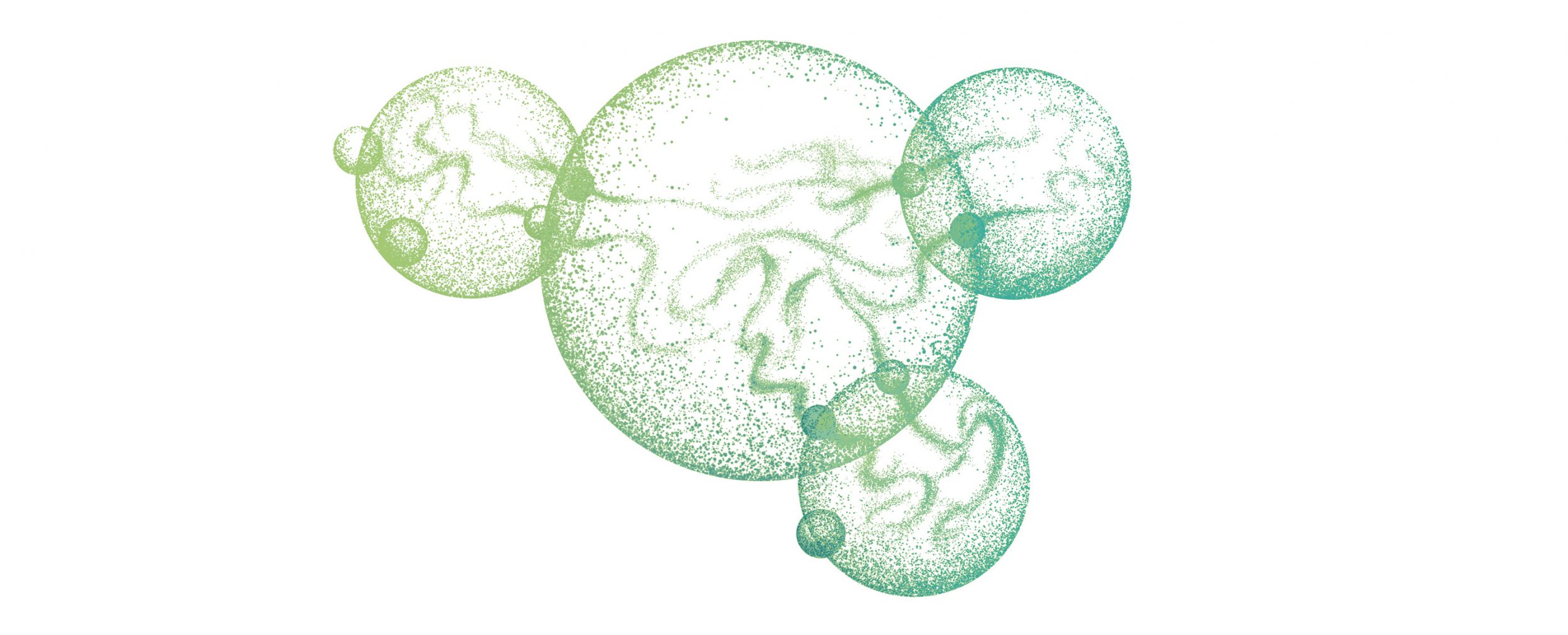
Die Soziokratie ist eine gemeinschaftsbasierte Governance-Methode, die auf Heterarchie baut (siehe folgendes Muster, Rau und Koch-Gonzalez sprechen von »kreisförmiger Hierarchie«). Sie trägt zu größtmöglicher Transparenz und Beteiligung bei und produziert effektive Ergebnisse auf Grundlage kollektiver Weisheit.[32] In der Beratungsbranche wird mitunter das entsprechende fachliche Wissen nicht großzügig weitergegeben. Wir bevorzugen daher gemeinschaftsfreundliche Ansätze wie Sociocracy for All, deren Materialien unter Creative-Commons-Lizenzen zur Verfügung gestellt werden.[33]
Eine weitere Methode, die vom Unterschied zwischen Konsent und Konsens ausgeht (siehe vorherigen Kasten), heißt »systemisches Konsensieren«. Das Verfahren wurde 2005 vom österreichischen Arzt und Mathematiker Erich Visotschnig entwickelt. Die Beteiligten werden zunächst gebeten, ihre Vorschläge einzubringen. Dabei ist es durchaus sinnvoll, viele Vorschläge zu entwickeln. Sie alle können problemlos bis zum Ende des Prozesses im Spiel bleiben und kommentiert werden. Im Laufe des Verfahrens werden sie dann hinsichtlich ihrer Nähe zum Konsens geordnet. Das geschieht, indem die Beteiligten jeden Vorschlag auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten. Dabei bedeutet 0 (überhaupt kein Widerstand) »Ich habe nichts dagegen. Ich unterstütze diesen Vorschlag voll und ganz« und 10 (maximaler Widerstand) »Ich habe erhebliche Einwände. Ich lehne diesen Vorschlag ganz und gar ab«. Alle bewerten die Vorschläge von 0 bis 10 entsprechend ihrer subjektiven Einschätzung. Meist wird eine kontextspezifische »Null-Option« angeboten, um zu signalisieren: »Alles sollte bleiben, wie es ist« oder auch: »Lasst uns die Entscheidung verschieben«. Dies ist eine Art »Vernunftgrenze«, über die erreicht werden soll, dass kein Vorschlag angenommen wird, der schlechter als diese Null-Option abschneidet. »Abschneiden« bedeutet, dass das System – sofern digitale Werkzeuge zum Einsatz kommen – die Vorschläge nach dem Gesamtwiderstand ordnet. Der Vorschlag mit dem geringsten Widerstand ist der, der dem Konsens und damit dem Interessenausgleich am nächsten kommt. Mehrsprachige digitale Plattformen wie konsensieren.eu ermöglichen aber uns allen jederzeit, rund um den Globus zu konsensieren, ohne viel Besprechungszeit zu verbringen, ohne die Themen von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren und ohne sich vom »Zentrum der Entscheidungsfindung« abgekoppelt zu fühlen.[34]
Und damit sind wir bei der zweiten Unterscheidung, die für gelingende Entscheidungsprozesse hilfreich ist: jene zwischen gemeinsamen Kriterien und Abstimmungen. Gemeinsame Kriterien können allgemeine ethische Standards oder auch praktische Aspekte sein, auf die sich alle Beteiligten eines kollektiven Prozesses geeinigt haben. Auf diese gemeinsamen Kriterien können sie zurückgreifen, wenn sie individuelle Entscheidungen treffen. Sie sind eine attraktive Alternative zu Abstimmungen, weil Menschen möglicherweise ihre Zeit lieber mit der Arbeit selbst verbringen als damit, komplexe Vorschläge zu debattieren und darüber abzustimmen. Bei Cecosesola, wo mittlerweile 1.400 Menschen zusammenarbeiten (siehe S. 126) gibt es keine Repräsentation, keine formale Delegation von Entscheidungen und keine Abstimmungen. Stattdessen werden die Dinge in offenen Treffen und Kreisen besprochen, die zum Arbeitsalltag gehören wie anderswo die Frühstückspause. Hunderte betriebliche Entscheidungen müssen Tag für Tag gefällt werden. Dabei ist oft solides Urteilsvermögen nötig, etwa wie im konkreten Umgang mit Patientinnen und Patienten damit umzugehen ist, dass es im Krankenhaus an Medikamenten fehlt. Oder damit, ob jemand bewusst eine Regel missachten soll, weil große Mengen Gemüse vier Stunden früher als erwartet angeliefert wurden und diese drohen, Schaden zu nehmen. Dennoch wird bei Cecosesola niemals abgestimmt. Es werden auch keine Vorgesetzten angerufen, einfach, weil es sie nicht gibt. Die Cecosesoler@s wollen damit verhindern, dass die Spaltung in Gewinner und Verlierer, Mehrheit und Minderheit täglich mehrfach reproduziert wird. Ihre Arbeit orientiert sich stattdessen an gemeinsamen Kriterien, die sie für alle möglichen Alltagssituationen entwickelt haben. So kann in der konkreten Situation »die Entscheidung selbst […] letztlich von ein, zwei oder drei Personen gefällt werden. Eines der gemeinsamen Kriterien ist, dass diejenigen, die die Entscheidung letztlich treffen, auch dafür verantwortlich sind, sie zu kommunizieren und zu verantworten.«[35] Noel Vale Valera beschreibt das Vorgehen so: »Bei unseren Treffen erwarten wir nie, dass gemeinsam Entscheidungen gefällt werden. Wir reden einfach viel darüber, wie und entlang welcher Kriterien eine Entscheidung zustande kommen kann.« Und das, ergänzt seine Kollegin Lizeth Vargas »funktioniert seit Jahrzehnten. Leicht ist es natürlich nicht. Wir sind schließlich 1.300 Personen[36]. Aber wir müssen auch nicht alles gemeinsam besprechen.« Der Grund? Die Beteiligten sind sich oft sicher, dass die Einzelnen im Sinne der gemeinsamen Kriterien entscheiden. Das heißt, dass sie selbständig gemeinstimmig entscheiden und anschließend mitteilen, was entschieden wurde.
Sich auf gemeinsame Entscheidungskriterien zu einigen – anstatt durch Abstimmungen zu entscheiden – erfordert nicht nur eine Kultur des Vertrauens, es fördert sie auch. Vertrauensbasiert und mit Hilfe gemeinsamer Kriterien die Einzelnen entscheiden lassen, das bringt deutlich mehr Flexibilität in kollektive Entscheidungsprozesse, und es sichert die Freiheit des Einzelnen, eine gegebene Situation eigenständig zu beurteilen. Dieser Prozess ist nicht hundertprozentig rational, er hat auch mit dem »richtigen Gespür« füreinander zu tun. Letztlich aber beruht er auf einem einfachen Grundgedanken: dem Vertrauen darauf, dass die Beteiligten einer Gemeinschaft oder eines Netzwerkes in den meisten Fällen das Richtige tun.
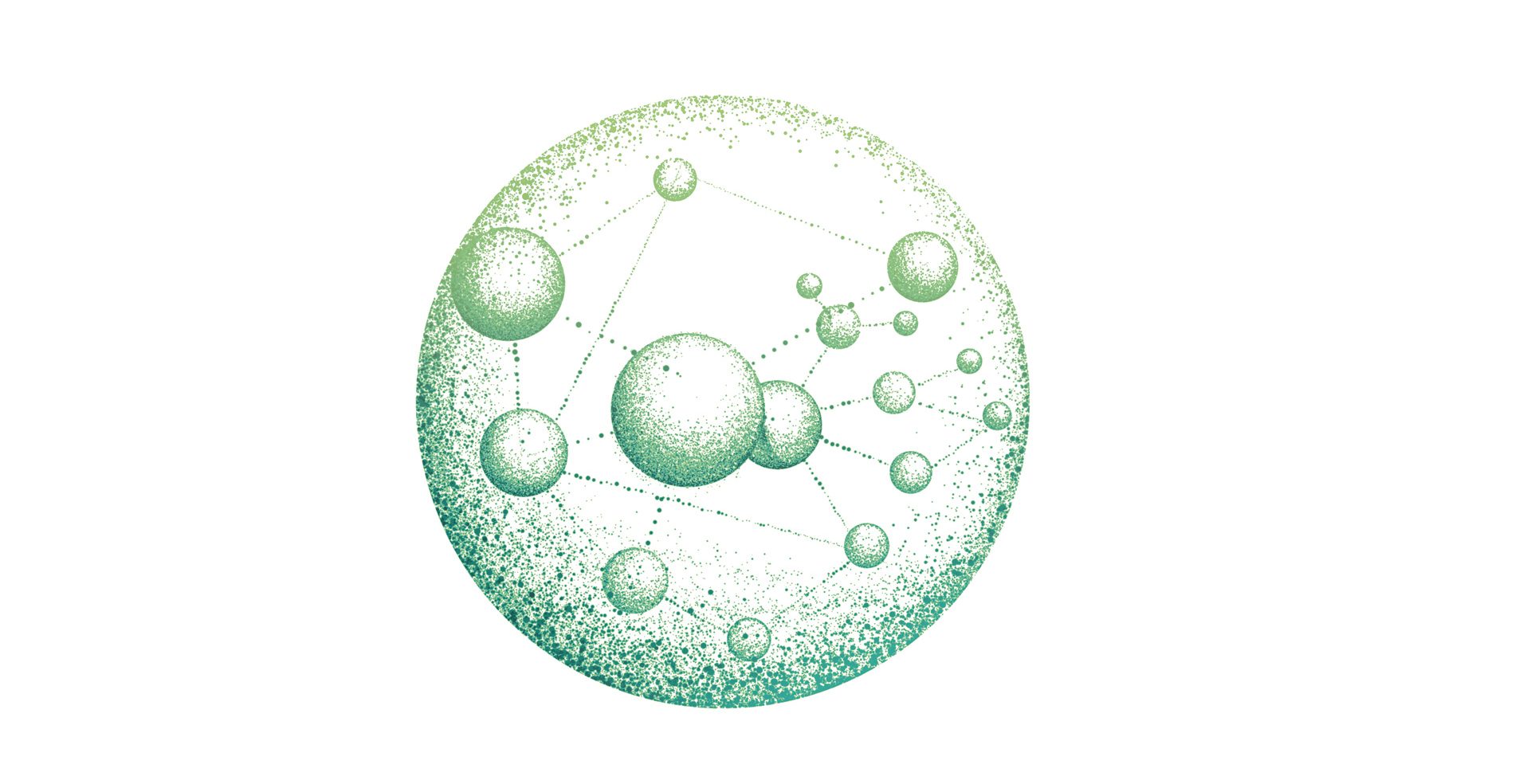
Commons funktionieren meist als Heterarchien. Sie sind fast nie ausschließlich hierarchisch organisiert. Eine Hierarchie weist Menschen klar definierte formale Rollen zu, die sich in einem pyramidenförmigen Organigramm darstellen lassen. Die Beteiligten werden immer kleineren Kategorien und Unterkategorien zugeordnet. Hierarchien sind durch Ränge definierte Ordnungen,[37] durch die Macht strukturiert, ausgeübt und gefestigt wird.
Heterarchien hingegen verbinden Organisationsformen auf Augenhöhe mit solchen, die von oben nach unten verlaufen (oder von unten nach oben – beides ist hierarchisch). Man kann sie sich als elegante Kombination von verteilten Netzwerken und Hierarchien vorstellen. Heterarchien können das Potenzial verantwortungsbewusster Autonomie entfalten und zugleich der Tatsache entsprechen, dass es oft notwendig ist, auf mehreren Ebenen zu agieren (Stichwort »Mehrebenen-Governance«). So kann eine größere Vielfalt von Organisationsformen entstehen und Abläufe oder Kooperationen können flexibler gestaltet werden als in konventionellen Hierarchien. In einer Heterarchie werden Macht und Befugnisse tendenziell »horizontal« verteilt, was den Einzelnen ermöglicht, sich im System ganz unterschiedlich zu positionieren. Aber Heterarchie und Hierarchie sind keine Gegensätze, es gibt also auch hierarchische Elemente. Entscheidend dabei ist, dass eine Heterarchie viele Möglichkeiten bietet, dieselben Elemente (oder ihre Bündel) miteinander zu verbinden oder voneinander zu trennen, so dass sich immer wieder neue Konfigurationen ergeben können. Die pyramidale Struktur wird dadurch gezähmt, dass sie mit horizontalen Strukturen verzahnt wird. Macht kann so dynamischer durch zahlreiche, wandelbare Knoten in einem Netzwerk fließen.

Wie wir am Beispiel von Cecosesola gesehen haben, ist es in einer Kultur von Vertrauen und Eigenverantwortlichkeit nicht unbedingt nötig, dass sich die Beteiligten vorab eine formale Erlaubnis einholen, wenn sie etwas tun wollen. Auch in den zahllosen Open-Source-Communities wird das nicht getan. Standard ist: Alle sind berechtigt zu handeln. Wenn sie einen Programmfehler sehen, können sie ihn beheben. Wenn sie eine gute Idee haben, können sie sie umsetzen. Wenn sie ein drängendes Problem lösen müssen, können sie damit beginnen. Später können individuelle Entscheidungen überprüft, angezweifelt oder gar aufgehoben werden. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Vertrauen auf die individuelle Initiative, die eingebettet ist in eine gemeinsame Handlungsintelligenz, erstaunlich verlässlich ist. Zudem bieten sich den Einzelnen mehr Entfaltungsmöglichkeiten im Rahmen bewusster Selbstorganisation, was wiederum ihr Selbstwirksamkeitsempfinden stärkt. Formale Repräsentations- oder Delegationsverfahren, wie wir sie aus dem politischen und wirtschaftlichen Leben kennen, sind also keine Voraussetzung, um komplexe, anspruchsvolle Aufgaben erfolgreich anzugehen. Im Vertrauensraum transparent zu sein, Wissen grosszügig weitergzueben und Teil eines Netzwerks gleichrangiger Beziehungen zu sein, all das erscheint weitaus angemessener. Wer jedoch anderes gewohnt ist, mag das befremdlich finden und in der Betrachtung heterarchischer Organisationsstrukturen seinen eigenen Augen nicht trauen. Als sich die Occupy-Wall-Street-Protestierenden im Zuccotti-Park in Manhattan organisierten, schrieb der New York Times-Kolumnist Nicholas Kristof: »Die Internet-Fähigkeiten der Protestierenden sind umwerfend, ihre Organisation ist beeindruckend. Der Platz ist aufgeteilt: Empfangsbereich, Medienzone, medizinische Betreuung, Bibliothek und Cafeteria. Links auf der Website der Protestierenden ermöglichen Unterstützenden in aller Welt, (bevorzugt vegane) Pizza von einer Pizzeria vor Ort online zu bestellen und zum Platz liefern zu lassen.«[38] Jedoch gab es keine zentrale Exekutive, die diese improvisierte soziale Ordnung leitete. Die Aktivistinnen und Aktivisten stellten fest, was getan werden musste, und koordinierten dann ihre Initiativen untereinander. Dennoch gab es Zuständigkeitsbereiche und auch (informelle) Hierarchien – jene, die den Medien Interviews gaben, und jene, die das nicht taten.
Der Wunsch zusammenzuarbeiten und dies auch in größerem Maßstab zu tun, gehört gewissermaßen zur Geschichte der menschlichen Spezies. Wir alle verspüren ihn. Wir wissen aber auch, dass spontane Formen der Peer-to-Peer-Organisation oft nicht von Dauer sind. In einer Zeit, in der Markt und Staat so viele Formen der Kooperation vereinnahmt haben oder kontrollieren, müssen neue Strukturen entwickelt werden, die uns helfen, dem Impuls nachzugehen und selbstbestimmt und verantwortlich für das Ganze zu bleiben. Die Muster der Triade des Commoning können solche Strukturen – innerhalb eines Commons – unterstützen und mit Leben füllen.[39] Eine heterarchische Strukturierung bewusster Selbstorganisation erlaubt nicht nur eine schnelle und wirksame Koordination, sie minimiert auch soziale Spaltungen und den bürokratischen Aufwand. Ungefähre Gleichheit ist so eher zu erreichen, denn eine heterarchische Struktur erlaubt es, formale Beziehungen innerhalb einer Organisation zu flexibilisieren. So lassen sich, wie es in der Wikipedia heißt, in jeder Situation »die Verknüpfungen von Herrschaft und Unterwerfung umkehren und Privilegien umverteilen«. Das liegt daran, dass in Heterarchien Gruppen »entsprechend mehrerer Anliegen in verschiedener Weise aufgeteilt und zugeordnet werden. Diese Anliegen rücken je nach Perspektive mehr oder weniger in den Blick. Entscheidend ist, dass keine einzige Möglichkeit, ein heterarchisches System zu unterteilen, jemals einen allumfassenden Blick auf das System bietet. Jede Unterteilung ist zweifellos unvollständig, und in vielen Fällen erscheinen uns – als Wahrnehmenden – diese Unterteilungen widersprüchlich, was zu Neustrukturierungen einlädt.«
Was Organisationen aus dem 20. Jahrhunderts eher fremd erscheint, ist im Zeitalter allgegenwärtiger digitaler Netzwerke – eine vollkommen plausible und funktionale Struktur bewusster Selbstorganisation.
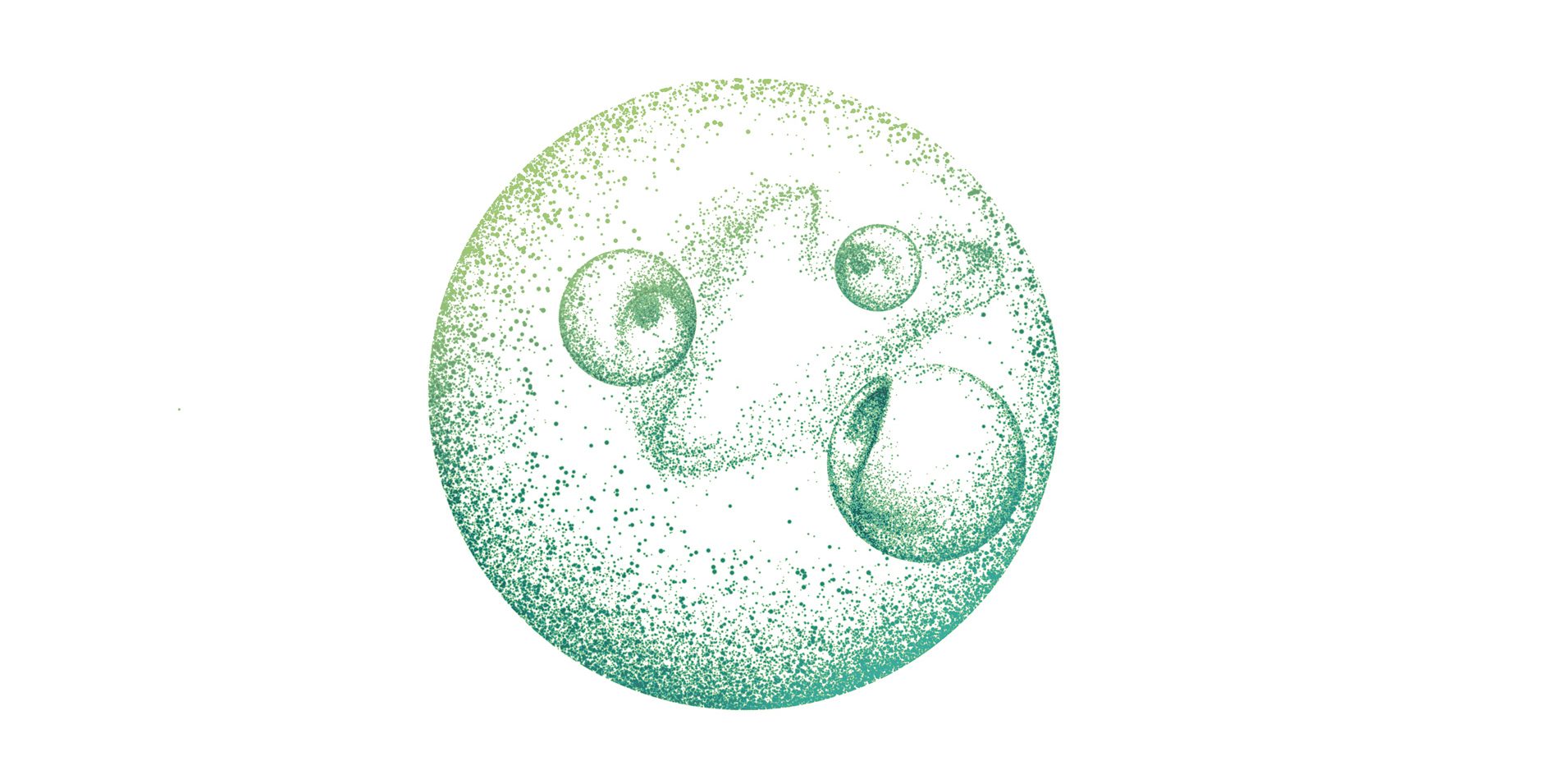
Kein Commons kann langfristig bestehen, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Beteiligten die Regeln befolgen, auf die sie sich geeinigt haben. Andersherum: Wenn »Trittbrettfahrerei« üblich wird oder Menschen einseitig Vereinbarungen aufkündigen, dann wird das gemeinsame Vermögen bald aufgebraucht sein und der Zusammenhalt sich auflösen. Sanktionen können solche Verhaltensweisen verhindern und gehören deswegen zu einer robusten Peer Governance. Wie aber sollen sie aussehen und wie angewandt werden? Dazu gibt es umfangreiche Literatur, teils aus der »Ostrom-Schule«, teils aus spieltheoretischen Untersuchungen. Verschiedene Disziplinen versuchen theoretisch und experimentell zu klären, wie und warum Menschen Vereinbarungen aufkündigen und wie darauf so zu reagieren ist, dass die Zusammenarbeit sich wieder verbessern kann. Elinor Ostrom selbst fand nach Abgleich verschiedener Fallstudien heraus, dass langfristig bestehende Commons meist über eine Reihe »abgestufter Sanktionen« verfügen. »Abgestuft« bezieht sich auf die Tatsache, dass die Strafen zunächst gering sind – etwa eine Warnung oder Aufforderung, das eigene Verhalten zu ändern. Sie verschärfen sich allmählich, wenn die Probleme nicht gelöst werden können. Sanktionen entfalten also eine mahnende Wirkung, die die Einhaltung von Regeln befördert. Abgesehen davon unterstreicht Ostrom, dass die bloße Existenz von Sanktionen als Mittel der, »Regeldurchsetzung das Vertrauen der Individuen [erhöht], daß sie nicht die ›Dummen‹ sein werden.«[40] Mit Verweis auf Margaret Levi nennt sie dies »quasi-freiwillige Regelkonformität« und rückt damit in den Blick, dass gelingende Zusammenarbeit viel damit zu tun hat, ob Menschen erkennen können, dass die Anderen ebenfalls die Regeln einhalten. Menschen sind durchaus bereit, etwas zu tun, was sie lieber vermeiden würden, wenn andere ebenso handeln. Das ist wie beim Steuern zahlen. Es bedeutet nichts Anderes, als dass in vielen Fällen die Androhung von Sanktionen ein wesentlicher Gelingensfaktor für ein langfristig stabiles Commons ist. Allerdings ist es ein enormer Unterschied, ob diese Form des »Zwangs« von innen kommt und die abgestuften Sanktionen mit Zustimmung aller Beteiligten vereinbart werden, also gemeinstimmig, oder ob sie von außen verfügt werden.
Interessanterweise ist bereits die bloße Existenz solcher Sanktionen wirksam, etwa, weil die sozialen Folgen von Regelverletzungen – insbesondere in Commons, in denen der Zusammenhalt groß ist – schwer wiegen. Daher müssen Strafen oft gar nicht verhängt werden beziehungsweise kommen eher selten vor. Sie spielen nicht für sich genommen, sondern im Zusammenhang mit anderen Mustern des Commoning eine eher untergeordnete Rolle. Michael Cox et al. haben in der Untersuchung eines Wassermanagementsystems in Simbabwe einmal angemerkt: »Menschen verbringen lieber mehr Zeit damit, einen Konsens auszuhandeln als Sanktionen einzuführen und zu verhängen.«[41]
Im englischen Great Lake District, dessen traditionelle Schäfereikultur von James Rebanks so brillant wie unterhaltsam beschrieben wurde, gilt es als unehrenhaft, wenn jemand einen anderen Hirten täuscht oder ein Schaf zu einem überhöhten Preis verkauft. In den Zanjera-Bewässerungsgemeinschaften auf den Philippinen werden Maßnahmen der Regeldurchsetzung dadurch gemieden, dass es eine Prüfung der Vertrauenswürdigkeit angehender Mitglieder gibt. Wer dazugehört und Regeln verletzt, wird teilweise suspendiert, im Wiederholungsfalle auch ganz ausgeschlossen.[42]
Für Commons mit einem starken sozialen Zusammenhalt ist die Existenz abgestufter Sanktionen zwar wichtig, deren Einsatz aber eher sparsam. Für solche, die auf flüchtigen, informellen Beziehungen beruhen – etwa digitale Gemeinschaften –, kann die klare Durchsetzung von Sanktionen eher notwendig sein.
Drei der in diesem Kapitel beschriebenen Muster haben einen besonderen Schwerpunkt. Sie sind darauf gerichtet, Commons vor den Risiken zu schützen, die von Geld, der Finanzwelt, modernen Eigentumskonzepten sowie dem Marktgeschehen ausgehen. Wir bündeln sie, weil sie gut beschreiben, wie der berechnenden Handlungsrationalität begegnet werden kann, die mit diesen Themen einhergeht. Die folgenden Muster fördern die Ubuntu-Rationalität sowie andere Dimensionen des Commoning; zugleich beschreiben sie, wie Geld zum Einsatz kommen kann, wo es notwendig ist.
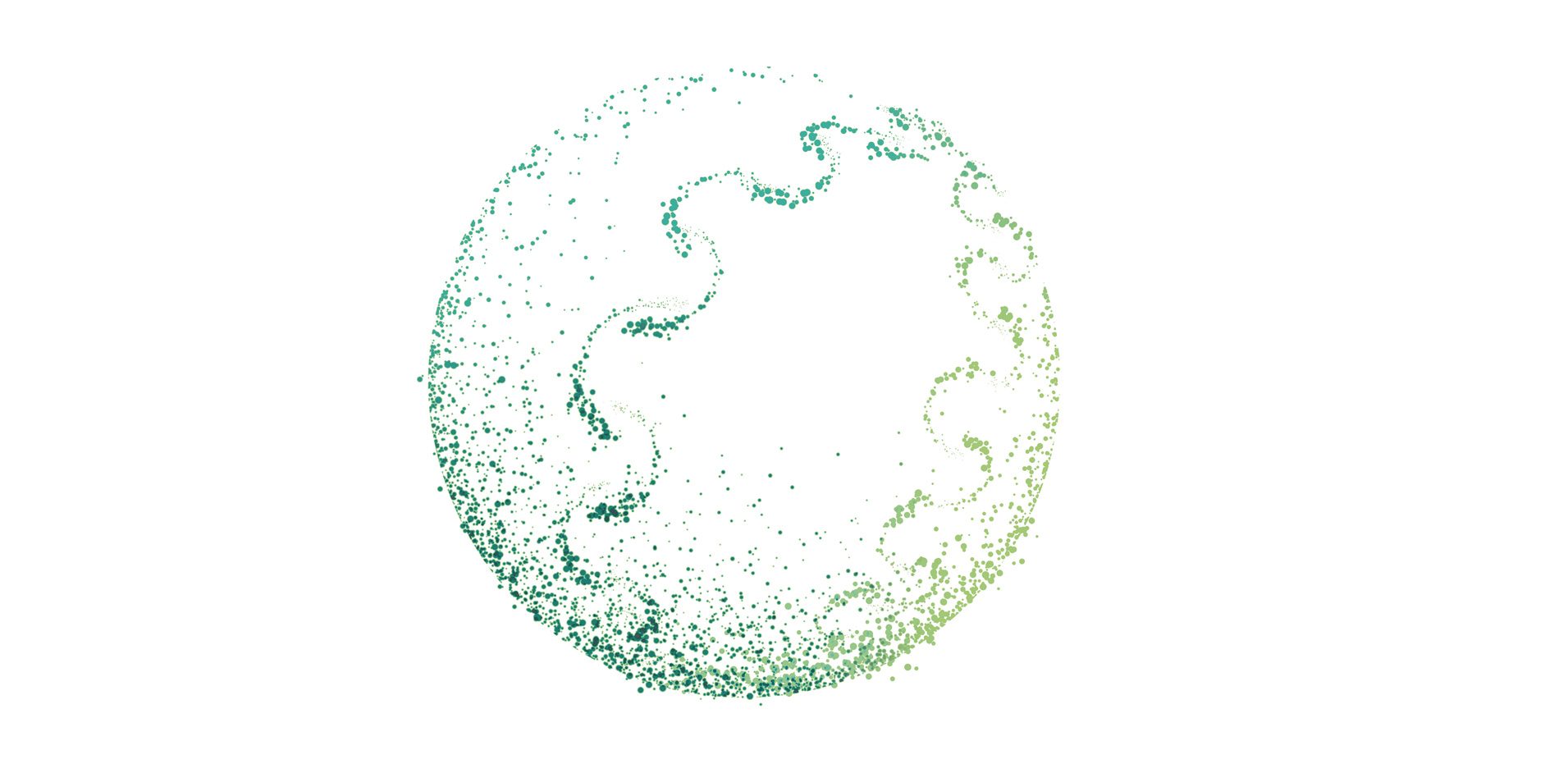
Auf vielen Häuserfassaden in deutschen Altstädten haben Handwerker eine traditionelle Weisheit eingraviert. Sie erinnern die Menschen daran, dass unsere Beziehungen zum Eigentum recht uneindeutig sind. So wie hier:
„Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem’s vor mir war, war’s auch nicht sein. Den dritten trägt man auch hinaus, Nun frag’ ich, wem gehört dies Haus?“Eines der Rätsel des Eigentums besteht darin, dass uns alle möglichen Dinge rechtlich »gehören« können. Was aber wirklich zählt, sind Besitz und Nutzung – und beides ist mit sozialen Beziehungen verknüpft. Bei dem Muster Beziehungshaftigkeit des Habens verankern geht es darum, dieser Wirklichkeit gerecht zu werden. Und das bedeutet für uns: dass das durch (Für-)Sorge geprägte Vermögen eines Commons nicht ausschließlich einer Person allein und auch nicht einer klar definierten Gruppe gehört. Denn es hat Ursprünge, die uns vorausgehen und uns wahrscheinlich auch überleben werden. Doch ähnlich wie der homo oeconomicus nur die Karikatur eines Menschen darstellt, verzerrt ein Eigentumsrecht die Welt, das viele der Beziehungen übergeht, die es zwangsläufig betrifft. Eigentum wird oft als etwas Unbewegliches, von uns Getrenntes angesehen. Als etwas – zumeist Dingliches –, mit dem wir tun können, was wir wollen.
Die Beziehungshaftigkeit des Habens verankern, das erfordert, Eigentum neu zu denken, sodass all dem Bedeutung zukommt, was untrennbar mit jeder Landschaft, jedem kreativen Wirken, mit Gebäuden oder Orten verbunden ist. Der französische Rechtsanthropologe Etienne le Roy hat zu Recht betont: »Was im rechtlichen und politischen Sinne wirklich zählt, ist die Interpretation des Begriffs ›gehören‹«. Was bedeutet es, dass Menschen Land, Wissen oder irdisches Leben ›gehört‹? Was bedeutet es für das Land, das Wissen und das irdische Leben? Was bedeutet es für mich und die Anderen? Und wie sollte das Gesetz solch komplexe Beziehungen erfassen und in Recht übersetzen? Diese grundlegenden Fragen werden oft gemieden, wenn eigentumsrechtliche Dinge zur Diskussion stehen. Am Ende wird es den Einzelnen – Eigentümerinnen und Eigentümern – überlassen, einseitig ihre Entscheidungen zu treffen. Nicht selten geschieht das zum eigenen Vorteil.
Und doch ist es so, dass Menschen tatsächlich die Beziehungshaftigkeit des Habens verankern. Sie haben es immer schon getan, und sie werden es auch weiterhin tun. Sie sind durch Erinnerungen und Erfahrungen mit bestimmten Gebäuden, Gewässern, Bergen und Wäldern verbunden. Sie kultivieren besondere Beziehungen zu Kunstwerken, Grab- und Kultstätten, zu öffentlichen Parks und Denkmälern. Oft sind dies die einzigen Gründe, warum ein Stück Land der Verwertungs- oder Nutzungsoptimierung entzogen wird. Der African Burial Ground in Manhatten ist dafür ein Beispiel. Es ist das einzige stehende Bodendenkmal mitten in New York, gleich neben dem Broadway gelegen. Bis 1784 wurden hier 15.000 Afroamerikanerinnen und -amerikaner nach Riten bestattet, die sie aus den afrikanischen Herkunftsländern mitgebracht hatten. Es war der einzige Friedhof für die noch weithin versklavte afroamerikanische Bevölkerung. Erst nachdem man 1991 im Zuge der Bauarbeiten für das riesige Bürogebäude des Bundes auf Skelette und Grabbeigaben gestoßen war, wurde der Friedhof »wiederentdeckt«. Archivunterlagen waren offenbar bei der Bauplanung nicht zu Rate gezogen worden. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Gelände parzelliert und als Bauland verkauft. Dabei hat die kellerlose Bebauung die Gräber lange geschützt. Nun sollte sich das ändern. Doch auch 200 Jahre nach der letzten Bestattung regte sich Widerstand. Die afroamerikanische Community erzwang den Baustopp. Mitten in Manhattan. Es kam zu öffentlichen Demonstrationen, Mahnwachen und schließlich zur Veränderung der Bauplanung. Lediglich ein Teil der ursprünglich vorgesehenen Fläche wurde anschließend überbaut. Auf der freibleibenden Fläche wurde eine Gedenkstätte errichtet. Ein Stück Grün blieb erhalten und Grabhügel aus der Wiederbestattung der gefundenen Überreste – inmitten der dichtbebauten Großstadt aus dem einzigen Grund, dass den Erinnerungen, Bindungen und Beziehungen vieler Menschen in der Stadt Bedeutung beigemessen wurde. In einem Commons werden solche Beziehungen anerkannt und respektiert. Zumindest lässt sich dies als Anspruch formulieren. So ist es verkürzt, die Diskussion um Eigentum als Entscheidung zwischen individuellen Rechten einerseits und kollektiven Interessen andererseits misszuverstehen.
Wie unsere Erörterungen über das Ich-in-Bezogenheit in Kapitel 2 bereits deutlich machen, ist es durchaus möglich, beides zu verschmelzen und eine Art »Ubuntu-Eigentum« zu denken und in die Welt zu bringen. Klöster tun dies seit Jahrhunderten. Zwar sind sie darauf ausgelegt, gemeinschaftliches Handeln zu fördern, doch selbst in den religiösen Orden wird darauf geachtet, dass die oder der Einzelne genügend privaten Raum zur Verfügung hat. So einfach die Behausungen oder Zellen auch sind, in denen Mönche und Nonnen leben – es ist ihr Rückzugsraum. In der berühmten Kartause von Florenz, idyllisch gelegen über dem Stadtteil Galluzzo, geht es etwas komfortabler zu. Die Mönche leben nicht in einfachen Zellen, sondern in einfachen Häusern, die auf der Mauer des Klostergeländes aufsitzen und den Anblick des architektonischen Ensembles prägen. Zu jedem dieser Häuser gehört ein Innenhof mit einem kleinen Garten sowie ein überdachter Außenkorridor, der den Mönchen auch bei Regen erlaubt, draußen und doch für sich zu sein. Niemand hatte Zutritt zu diesem geschützten Lebensbereich. Das Kloster ist so konzipiert, dass die Eingangstüren der Häuser auf den Kreuzgang führen, der von allen genutzt wird. Auch in mittelalterlichen Commons gibt es diesen Raum zur individuellen Nutzung. Das Common Law kennt die Curtilage, ein Begriff, der das Land rund um das Haus bezeichnet. Erst Wohngebäude und Curtilage machte das Haus zum Heim. Dieses Land wurde nur von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt, während die weiter entfernt liegenden Felder gemeinsam bewirtschaftet wurden. Curtilage hat sich bis in die moderne Rechtsprechung erhalten. Nach einer Urteilsbegründung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten schützt sie die »intime Aktivität, die zur Heiligkeit des Hauses eines Mannes und zur Privatheit seines Lebens gehört«.[43]
Auch die Landnutzungspraktiken der brasilianischen Landlosenbewegung (Movimento Sem Terra, MST) verbinden individuelle und kollektive Interessen. Alle gemeinsam nutzen und verwalten besetzte Ländereien, aber kein Einzelner und kein Kollektiv kann vollständig über das Land verfügen. Auf MST-Land können die Familien Grundstücke individuell bewirtschaften und für beliebige Zwecke nutzen, aber niemand kann ein einzelnes Stück Land aus dem von der Bewegung gemeinsam verwalteten Land »herausschneiden«. Wer die Bewegung verlässt, gibt auch das Land auf. Mit anderen Worten, das Schicksal der Einzelnen ist eng mit dem des Kollektivs verbunden. Hunderttausende brasilianischer Familien[44] leben in Landbesetzungen des MST oder haben dort gelebt. Anliegen der Bewegung war stets, für eine bessere Landverteilung zu streiten und ungenutzte Ländereien für kleinbäuerliche Landwirtschaft verfügbar zu machen. Konzepte und Praxis der MST sind stark von der katholischen Soziallehre inspiriert, für die Gemeinwohl, Subsidiarität und Solidarität als sozialethische Ordnungsprinzipien gelten.[45] Ähnliche Ideen sind in unserem Grundgesetz verankert, das in Art 14 besagt: (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig.
Diese Verpflichtung auf das Gemeinwohl ist auch der Grund, warum in vielen Gemeinschaftsgärten die Regel gilt: »Use it or lose it«. Anders als vollumfängliche Eigentumsrechte erkennt sie an, dass es auf den tatsächlichen Gebrauch ankommt. Das gehört – genau wie für die organische Verbindung von individuellen und kollektiven Interessen – zum Kern eines anderen Eigentumsverständnisses, so wie wir es in Kapitel 8 vorstellen werden. Darin untersuchen wir anhand von fünf konkreten Beispielen »andere Formen des Habens«. In allen Fällen tragen sie dazu bei, einige Herrschaftsverhältnisse und Abhängigkeiten, die konventionelle Eigentumsrechte mit sich bringen, abzubauen.
Park Slope Food Coop gelingt das über die Kopplung von Miteigentümerschaft und nicht-kommerzialisierter Arbeit. Die Open Source Seed Initiative hat Pionierarbeit geleistet, um Saatgut zugleich zu schützen und freizugeben. Ein großer Verbund deutscher Wohnungsbauprojekte, das Mietshäuser Syndikat, hat dazu beigetragen, dass viel Wohnraum vom Markt genommen wird, und sichert bei Selbstverwaltung der Beteiligten Wohnprojekte ab, dass die Wohnungen wieder zur Ware werden. Sie alle stellen die Idee des »existentiellen Mitbesitzes und des realen Gebrauchs« über die »absolute Herrschaft« an dem, was uns letztlich nie ganz gehört, wie uns die Handwerker des Mittelalters erinnern.
Beziehungseigentum berücksichtigt unsere Sozialbeziehungen, unsere Beziehungen zur nichtmenschlichen Welt sowie zu vergangenen und künftigen Generationen.
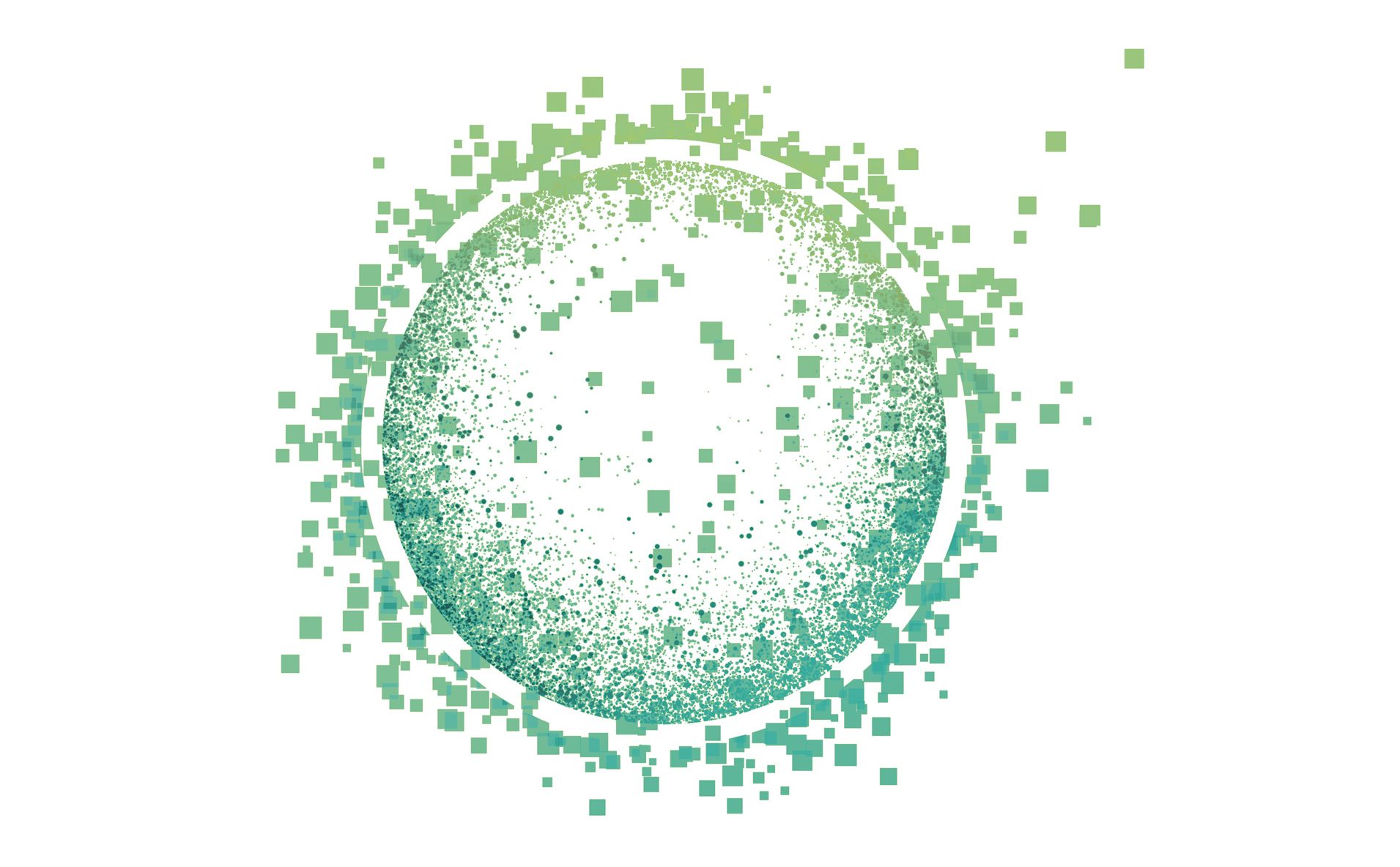
Sie mögen sich fragen, warum Genossenschaften häufig als Beispiele für Com-mons genannt werden, obwohl viele ausschließlich für den Markt produzierenund sich ausschließlich über ihn tragen. Es gibt Zehntausende Genossenschaf-ten und Kooperativen. Der International Co-operative Alliance zufolge bringensie »mehr als eine Milliarde Menschen in der ganzen Welt« zusammen.[46] WennGenossenschaften beziehungsweise Kooperativen so stark sind, warum sitzt danndas vorherrschende Wirtschaftsmodell nach wie vor fest im Sattel? Ein Grund ist,dass viele kooperative Organisationsformen das folgende Muster nicht realisieren:Commons & Kommerz auseinanderhalten! Und das Recht trägt das Seine dazubei. Fast immer privilegiert es marktbasierte gegenüber commons-basierten odernicht-marktbasierten Aktivitäten. Eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Com-mons ist es daher, die Integrität aufrechtzuerhalten – angesichts einer Marktord-nung, die auf Ausbeutung und Verdrängung ausgerichtet ist. Ein Commons musssich schützen. Zwingend. Sonst läuft es Gefahr, durch Einhegungen zerstört zuwerden.
Einhegungen gefährden Commons
Einhegung ist der Gegenbegriff zu Commoning, denn es ist ein Prozess, der voneinander trennt, was Commoning miteinander verbindet – Menschen und Land, Sie und mich, heutige und zukünftige Generationen, Infrastrukturen und ihre Steuerung, Naturschutzgebiete und die Menschen, die sie seit Gene rationen (für-)sorgend bewirtschaften. Einhegungen werden im Allgemeinen – aber nicht ausschließlich – von Investoren und Konzernen vorangetrieben, um Land, Wasser, Wälder, Gene, kreative Inhalte und vieles andere, das gemeinsam genutzt wird, zu ihrer Ware zu machen. Dies geschieht weltweit und häufig in Abstimmung mit dem Staat. Einhegung ist Enteignung und kulturelle Zerschlagung zugleich. Sie zwingt Menschen nicht nur in die Marktabhängigkeit, sondern auch in marktkonformes Denken. Im Ergebnis müssen sich Menschen Zugang zu lebensnotwendigen Dingen kaufen. Sie müssen sich den äußeren Bedingungen und Preisen beugen, die Investoren in ihrer Eigenschaft als Eigentümer setzen. Oder sie benötigen fortan eine Erlaubnis, um jene Lebensgrundlagen zu nutzen, die sie bislang selbst (für-)sorgend be wirtschaftet haben. Commons sind aber auch dann gefährdet, wenn sich Menschen Alternativen zum Markt kaum vorstellen können. In solchen Fällen droht eine »Vereinnahmung von innen«. Etwa wenn gebetsmühlenartig das Argument wiederholt wird, dass es keine andere Möglichkeit gibt, etwas Wegweisen des umzusetzen, als sich Kapital am freien Markt zu besorgen. Guifi.net (siehe Kapitel 1) oder Holochain (siehe Kapitel 10) beweisen das Gegenteil. Tatsächlich ist dieses Denken ohne Alternative oft der Grund dafür, dass Projekte scheitern. Ein Beispiel sind die Anfangsjahre von Nextcloud (siehe S. 148).
Einhegungen bringen letztlich alles zu Fall: die Kultur des Soziallebens, besondere Formen des Wirtschaftens und Praktiken bewusster Selbstor ganisation, kurz: die Seins-, Arbeits- und Lebensweise. Sie untergraben das Sinnstiftende des Commoning und leisten einer berechnenden Rationalität genauso Vorschub wie kurzfristigen, unpersönlichen, rein marktvermittelten Beziehungen.
In einer Gesellschaft, in der sich so vieles um Geld dreht, ist es praktisch unmöglich, der Kollision zwischen Commons und Kommerz zu entgehen. Mako Hill, Wissenschaftler und Programmierer von freier Software, beschreibt, wie viele Programmierfachleute »ihre Entwicklungsumgebung als radikal verändert [erleben], manchmal zum Schlechteren, wenn in ihren Communities bezahlte Arbeit Einzug hält«.[47] Kommt in der Programmierung freier Software (genau wie in anderen Prozessen) Geld ins Spiel, dann führt dies zu einem »neuen Arbeitsstil und anderen Beziehungen zwischen den Entwicklungsfachleuten«. Commoners verlieren die Motivation, ohne Zwänge beizutragen (siehe S. 101). Das geschieht nicht etwa, weil sie das prinzipiell nicht tun oder es sich nicht leisten können, sondern weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, wenn die einen bezahlt werden und die anderen nicht. Wird Geld zur Motivation genutzt, beginnen Menschen sich anders zu orientieren und auf Ziele zu konzentrieren, die »für den Markt« interessant sind. Langsam aber sicher unterminiert die Anziehungskraft des Geldes die Integrität des Commoning. Das zeigt sich in den Sozialbeziehungen, in den Dingen, die fortan als wichtig gelten, sowie in den langfristigen Zielen. Hill führt Belege dafür an, dass Bezahlung problematisch ist, wenn sie dort eingeführt wird, wo viele Menschen freiwillig beitragen und sich sozial engagieren. Jenen, die freiwillig dabei sind, erscheint ihr Beitrag auf einmal nicht mehr unabdingbar und weniger bedeutend. Das führt dazu, dass sie tatsächlich weniger beitragen oder sich sogar zurückziehen.[48] Ist Geld erst einmal da, stellt sich zudem die Frage, wie es ausgegeben werden soll und wer darüber entscheidet. Mako Hill schreibt: »Für ein erfolgreiches Freie-Software-Projekt, zu dem viele freiwillig beitragen, ist es leichter, Geld zu bekommen, als zu entscheiden, wie es ausgegeben werden soll.« Nun ist das gewiss kein unlösbares Problem. Zudem können viele Bedürfnisse nur über Märkte befriedigt werden. Geld wird also gebraucht. Wenn aber unreflektiert erkauft wird, was Commoning genauso gut leisten könnte, dann werden intrinsische Motivationen verschwinden.
Sicher brauchen auch Commoners Geld, wenn auch verhältnismäßig wenig. Im Mittelalter trugen die Allmenden zur Befriedigung vieler Grundbedürfnisse bei – vergleichbar einem »Grundauskommen«. Der Zugang zu Naturreichtümern half dabei, über die Runden zu kommen. Geld wurde nur für gelegentliche Anschaffungen gebraucht. Heute ist der Umgang mit Geld kaum vermeidbar. Commoners können (und müssen) sich meist um ein »Geldeinkommen« bemühen. Und so wichtig das ist, so wichtig ist auch, sich dabei von regelmäßigen Geldflüssen möglichst unabhängig zu machen. Das gelingt nicht von heute auf morgen, aber es gibt viele Möglichkeiten, geldunabhängiger zu leben. Vor allem erfordert es die Fähigkeit, den Spieß umzudrehen und die richtigen Fragen zu stellen. Anstatt zu fragen: »Wie kann ich mehr Geld verdienen?«, stellt sich die Frage: »Wie kann ich mein Leben so organisieren, dass ich weniger Geld brauche? Wie kommt mehr Teilen und Weitergeben in meinen Alltag?« Auch auf Projekt-, Initiativ- oder Plattformebene kann mit diesen Fragen begonnen werden.
Eine weitere Strategie ist, die Geldflüsse innerhalb eines Commons davon zu entkoppeln, wie »das Geld hineinkommt«, also wie Einnahmen generiert werden. Wie sieht eine solche Entkopplung aus? Wenn Menschen es gewohnt sind, Dienstleistungen zu kaufen, verhalten sie sich entsprechend. Sie denken und handeln wie Konsumierende. Wann immer dieses Rollenbild aktiviert wird, kommt eine berechnende Rationalität zum Zug: Wenn eine »Ausschreibung« stattfindet und sich die Bietenden gegenseitig übertreffen beziehungsweise unterbieten müssen; wenn in Verträgen Ergebnispakete geschnürt werden, die dann »geliefert« werden müssen – egal wie die Bedingungen im richtigen Leben sind; wenn alles als »Kauf- und Verkaufstransaktion« gedacht wird, gleich ob es sich um Fahrräder, Lebensmittel, Fortbildung oder Fußballspieler handelt; wenn gewarnt wird, dass Andere Ihnen zuvorkommen, wenn Sie jetzt nicht zugreifen – immer dann regiert das Geld durch. Das Problem dabei: Geldflüsse und Warentausch können Commoning so wenig ersetzen wie (Für-)Sorge. Nicht nur im Vollzug des geldvermittelten Wirtschaftens setzt sich der Konsumierende in uns durch; schon die Grundüberzeugung, dass »nur so etwas erledigt werden kann«, dass es »schlicht nicht anders geht«, nährt diese Haltung. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten, aus einem Commons heraus mit dem Markt zu interagieren, ohne der Logik der Preiskonkurrenz zu folgen oder sich – wie im Äquivalententausch – strikter Gegenseitigkeit unterzuordnen. Als eine Stadt in Frankreich dem commons-basierten Netzwerk Encommuns, zu dem viele Programmierfachleute gehören, einen Auftrag anbot, trug dies plötzlich die Vorstellung, »liefern zu müssen« in die Gruppe. Die Konzentration auf den Auftrag hat die Beteiligten von den ursprünglichen Projektzielen entfernt und selbstbestimmte Arbeitsrhythmen verdrängt. Ein Beteiligter berichtet, wie sich »eine Kluft [öffnete] zwischen denen, die für diesen Auftrag viel liefern und das Geld bekommen, und jenen, die [nur] von Zeit zu Zeit liefern [können] und das ohne Bezahlung tun«.[49] Das Ergebnis: eine Verschiebung in den internen Dynamiken des Commoning. Anstatt aus intrinsischen Gründen (Spaß an der Aufgabe, Netzwerken, von Anderen lernen, Sozialleben, Sinnvolles tun) zum Projekt beizutragen, konzentrierten sich viele darauf, »den Vertrag zu erfüllen«. Bald wurden die Prioritäten des externen Auftraggebers als wichtiger erachtet als die Wünsche und Bedürfnisse anderer Commoners. Die Logik des Wettbewerbs und der Effizienz trieb ins Zentrum der Aufmerksamkeit und drängte die ursprünglich freiwillige Zusammenarbeit in den Hintergrund. »Anstatt Menschen zu helfen, die von einem fehlerhaften Wirtschaftssystem ausgelösten Verhaltensweisen zu ändern«, so wie Encommuns das beabsichtigt hatte, hat diese Dienstleistungsorientierung »diese Verhaltensweisen verstärkt«, sagte ein Beteiligter.
Encommuns reagierte mit der Schaffung einer halbdurchlässigen Membran, um den Geist des Commoning zu erhalten und gleichzeitig kommerzielle Aufträge annehmen zu können. Zunächst legte die Gruppe fest, dass alle kommerziellen Unternehmen die Leistungen bezahlen sollten, die im Commons erbracht wurden – das stellte die Möglichkeit sicher, Einnahmen zu generieren. Anstatt dies aber als konventionelle Markttransaktion zu betrachten – also als Bezahlung für bestimmte Leistungen oder Produkte – sieht die Regelung vor, dass jedes beauftragende Unternehmen einen finanziellen Beitrag zum Commons leistet und damit die Tätigkeiten grundfinanziert, denen die Commoners ohnehin nachgehen. Mit anderen Worten: Unternehmen oder staatliche Auftraggeber zahlen nicht für eine bestimmte Dienstleistung oder ein bestimmtes Produkt, sondern sie leisten einen allgemeinen Beitrag – ähnlich einer Spende. Diese Beiträge werden zudem alle offengelegt. Encommuns will dadurch sicherstellen, dass es nicht davon abhängig wird, etwas zu verkaufen, weder Produkte noch die Arbeit der Menschen, denn die Erfahrung ist, dass – wenn dies geschieht – allmählich dem Erfolg am Markt mehr Priorität eingeräumt wird als den Bedürfnissen der Commoners. Und damit beginnt nicht selten die Auflösung des ganzen sozialen Gefüges. Indem Encommuns Zahlungen (allgemeine Kompensationen für das Recht, die Ergebnisse ihrer Programmierkunst zu nutzen) formal wie Spenden behandelt, entkoppelt es das Geben vom Nehmen. Die finanziellen Beiträge von außen sind nicht direkt mit dem verknüpft, was von außen aus dem Commons genommen wird. So bleibt Encommuns souverän im Umgang mit Geld im Sinne des Gesamtprojekts. Zudem sei die Idee, »kommerziellen Organisationen zu helfen, Vertrauen in den Commons-Ansatz zu entwickeln und gleichzeitig Commons zu helfen, sich zu finanzieren, wenn sie schon zu kommerziellen Zwecken genutzt werden«.[50] Derselben Idee folgt die P2P Foundation mit ihrer sogenannten commons-basierten »Reziprozitätslizenz« (Commons Based Reciprocity License). Sie ermöglicht allen, kostenlos zu nutzen, was in Commons produziert worden ist – mit Ausnahme kommerzieller Nutzer. Sie sollen zahlen.
Das transnationale Guerrilla Media Collective (GMC) – eine Gruppe von Übersetzern, Designerinnen und Medienschaffenden – hat sich Regeln gegeben, die sowohl Commoning als auch bezahlte Dienstleistungen integrieren. Das »commons-orientierte offene und kooperative Wirtschafts- und Governance Model, Version 2.0«, ermöglicht es den Beteiligten, zweckgebundene und gemeinwohlorientierte bezahlte Arbeit zu leisten, und fordert zugleich explizit, für das Wohlergehen des Kollektivs und jedes Einzelnen Sorge zu tragen.[51] Entscheidungsverfahren und Verantwortlichkeiten sind nach unterschiedlichen Stufen des Engagements ausdifferenziert: gelegentliche, unbezahlte Beteiligung; ein formaler Prozess, der einer Probezeit ähnelt, teilweise bezahlt wird und Raum schafft, um zu prüfen, ob alles zusammenpasst; sowie verbindliche Mitgliedschaft mit spezifischen Verantwortlichkeiten, die bezahlt werden. Alle wertschöpfenden Beiträge – auch die unbezahlten, inklusive der (Für-)Sorge für das GMC – werden in einer Datenbank erfasst. Diese Erfassung ist Referenzpunkt für die Reflexion und entspricht dem Bemühen aller Beteiligten, dem Commoning Priorität einzuräumen.
Im Grunde sind all diese Dinge nicht neu. Um Commons & Kommerz auseinanderzuhalten, wird in vielen Gemeinschaftswäldern das Sammeln und Schlagen von Ästen oder Bäumen nur für den persönlichen Gebrauch, nicht aber für den Verkauf auf dem Markt erlaubt. Fischerei-Commons bestimmen häufig, welcher Anteil des Fangs von einzelnen Fischerinnen oder Fischern verkauft werden darf. Doch das Muster findet sich nicht nur in Commons: Auch Universitätsverwaltungen fungieren oft als Vermittler zwischen Finanzierungsquellen und den Forschenden selbst. Die Idee ist sicherzustellen, dass in der Wissenschaft von den Interessen der Geldgeber unabhängige Debatten geführt und Ergebnisse verbreitet werden können. Auf die Erkenntnisse der Wissenschaft darf nicht der Makel fallen, etwa von Konzerninteressen beeinflusst zu sein.
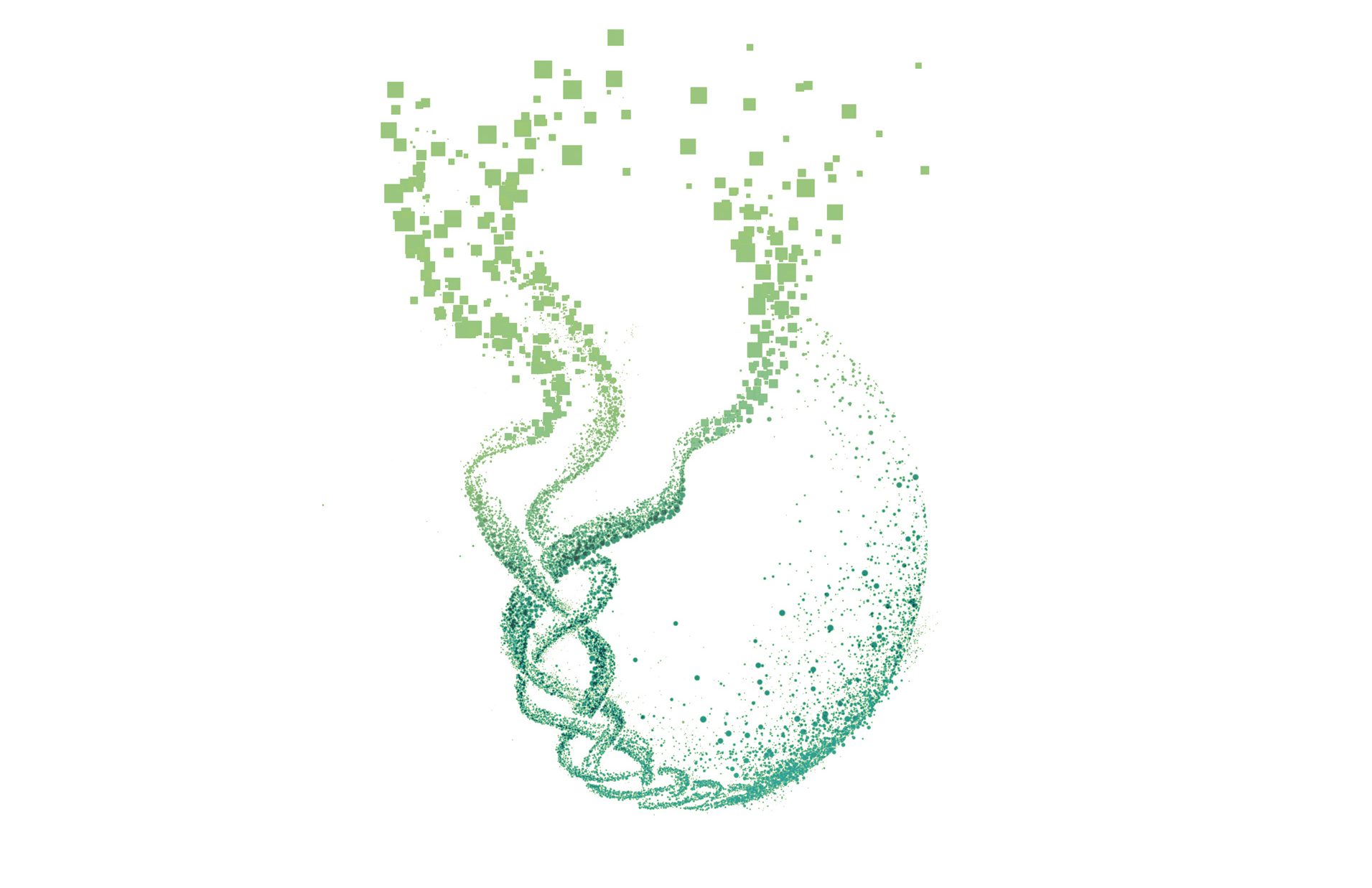
In einer Welt, in der Geld und Finanzierung nach kapitalistischer Logik eingesetzt werden und als Standardinstrumente, stellt sich die Frage, wie schöpferisches Tätigsein finanziert werden kann, ohne die schädlichen Einflüsse von Geld und Verschuldung hinnehmen zu müssen. Drei Möglichkeiten haben wir ausgemacht – gewiss gibt es mehr. Sie erlauben es Commoners von externer Finanzierung unabhängiger zu werden und geben ihnen zugleich mehr Sicherheit und Freiheit. Die Rede ist von, erstens, »Geld-light-Commoning«, was mit sich bringt, weniger auf Geld und Märkte angewiesen zu sein; zweitens, gemeinsamer Finanzierung, so dass Geld und Kredite ausschließlich aus dem Commons heraus entstehen, darin zirkulieren und nicht zweckentfremdet werden; und, drittens, von neuen Finanzkreisläufen zwischen Commons und der öffentlichen Hand, so dass vom Staat verwaltete Steuergelder Commons stärken können. (Wir kommen gleich darauf zurück.)
Wie wir gesehen haben, hängt das Gelingen des Commoning davon ab, dass Geld nicht die sozialen Dynamiken bestimmt. Wenn Schulden oder Kapital die Menschen in Abhängigkeiten treiben oder soziale Spaltungen erzeugen, wird ein Commons nicht bestehen können. Deswegen ist es so wichtig, dass Commoners (im Grunde aber wir alle), unabhängiger von Geld und Märkten werden. Wenn etwa die Emission und die Zirkulation von Geld auf Augenhöhe geschehen und das Geld sich vor allem innerhalb der Gemeinschaften, Netzwerke und Commons-Prozesse bewegt, dann können Commoners die Werte, die sie schaffen, zum gegenseitigen Vorteil nutzen. Und sie müssen nicht zusehen, wie sie von Kreditgeberinnen und Aktionären als Zins- oder Dividendenzahler abgeschöpft werden.
Wie Google ohne Google: Nextcloud
Nextcloud[52] ist heute eine beliebte Alternative zu Diensten wie Dropbox oder OneDrive. Sie ermöglicht, dass Daten auf den je eigenen Servern gespeichert werden (sog. Filehosting), und beruht auf Open Source und freier Software. Über einen sogenannte Klienten (engl. client) wird der Server automatisch mit den lokalen Verzeichnissen synchronisiert. So können alle Beteiligten von mehreren Rechnern, aber auch über eine Weboberfläche, auf einen konsistenten Datenbestand zugreifen. Nextcloud kann, anders als proprietäre Dienste, ohne Zusatzkosten auf einem privaten Server installiert werden. Das sichert die vollständige Kontrolle über die eigenen Daten. Der Dienst bietet alles, was Google auch bietet. Und da die Software modular aufgebaut ist, lässt sie sich um beliebige Funktionalitäten erweitern. Es gibt Kalender, Adressbuch, Fotogalerie, Musik- und Videowiedergabe, Aufgabenplaner, Feedreader, E-Mail-Programm, Textverarbeitung, Mind Maps, Verwaltungswerkzeuge, Möglichkeiten zur Auswertung von Geodaten und so fort. 1.800 Leute arbeiten mit – unbezahlt. Sie tun es trotzdem. Auf der Konferenz Bits & Bäume, die im November 2018 in Berlin erstmals die Umweltbewegung mit der kritischen Technologieszene zusammengebracht hat, beschreibt der Gründer von Nextcloud, Frank Karlitschek, eine Erfahrung, die ihn gelehrt hat, bei der Finanzierung einer Unternehmung auf Unabhängigkeit zu achten.[53] Karlitschek hatte auch den Nextcloud-Vorgänger OwnCloud gegründet. Um seine Idee einer freien, selbstgehosteten Cloud zu realisieren, ging er in die USA, ins El Dorado der Start ups. Und tatsächlich bekam er, was er suchte: Venture-Kapital. Das beschleunigte die Dinge: schnelleres Wachstum, mehr Marketing, mehr Einstellungen. Aber dabei sei »das Projekt unter die Räder geraten«, sagt Karlitschek. OwnCloud hatte mehrere Millionen US-Dollar eingesammelt und musste nun mit Rücksicht auf die Interessen der Investoren agieren. »Das war ein Fehler«, resümiert er. »Die Kompromisse waren zu groß.« Karlitschek hat sein Projekt verlassen[54] und ein neues gegründet: Nextcloud – ohne externe Investitionen und unter Beteiligung einer großen Community. Nur zwei Jahre nach der Gründung hat Nextcloud Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt – darunter sehr große: die ARD etwa oder Siemens.
Der französische Informatiker und Commons-Forscher Philippe Aigrain hat bereits zu Beginn der 2010er-Jahre deutlich gemacht, dass in jedem Commons einige grundsätzliche Fragen zu klären sind. So ist zu fragen, wie die Beziehungen zwischen der Geldökonomie und den Commons aussehen sollen und welche »Geldkultur« Commoners für sich selbst entwickeln wollen. Zumindest sollten diese Dinge so geregelt werden, dass Kapital oder Geld nicht unkontrolliert alles durchdringt und sich das Miteinander nicht in ein Gegeneinander verwandelt. Es geht darum zu erkennen, dass das Streben nach Geld und Erfolg nicht alternativlos ist, wenn allgemeiner Wohlstand geschaffen werden soll. Deshalb ist es zwingend, Commons & Kommerz auseinanderzuhalten (S. 143). Aber auch Gegenseitigkeit behutsam auszuüben (S. 103) minimiert die negativen Folgen der Geldökonomie und trägt dazu bei, dass eine berechnende Handlungsrationalität nicht doch zur kulturellen Norm wird. Und damit sind wir bei den Strategien, die das gleiche Anliegen verfolgen. Es ist gleichgültig, welche zum Einsatz kommt: Wichtig ist, dass »der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt« und wir nicht zulassen, dass Geld unsere Anliegen bestimmt und unser Handeln antreibt.
Geld-light-Commoning. Wenn Commoning bedeutet, Wissen und Dinge gemeinsam zu nutzen, aufzuteilen und umzulegen sowie Prozesse gemeinsam zu finanzieren und dadurch so viele Bedürfnisse wie möglich zu befriedigen, dann macht es die Einzelnen per Definition unabhängiger von Geldeinkommen. Wir nennen es daher »Geld-light«. Die Ethik und Praxis von Geld-light-Commoning wird in diesem Buch in vielen Varianten beschrieben. Wir brauchen weniger Geld, wenn wir Dinge gemeinsam tragen, nutzen und herstellen, »Do-It-Together« ist dafür ein Schlagwort. (Gemeinsam nutzen & herstellen ist ein entsprechendes Muster, das wir in Kapitel 6 beschreiben.) Geld-light-Commoning ist fundamental, relativ einfach und eine Antwort darauf, dass »der Markt« unsere Schwächen auszunutzen sucht und Abhängigkeitsverhältnisse herstellt. Wir kennen das von unseren Staubsaugern oder Schleifmaschinen. Die Anschaffungskosten der Geräte sind im Vergleich zu dem, was wir für das Verbrauchsmaterial wie Staubsaugerbeutel, Schleifpapier oder Druckerpatronen ausgeben müssen, geradezu lächerlich. Eine der wirksamsten Antworten darauf ist, solche Anschaffungen möglichst zu vermeiden und nach Alternativen zu suchen – etwa Geräte umzurüsten, gemeinsam zu nutzen oder konviviale Technologien einzusetzen. Langfristig macht uns das freier.
Noch deutlicher wird die Abhängigkeit von kommerziellen Interessen im IT-Bereich. Heute werden die Konsumentinnen und Konsumenten proprietärer Softwarenicht nur gezwungen, ständig neue Versionen zu akzeptieren, sondern, wie Professor Lorenz Hilty erklärt: »Heute wird immaterielle Software benutzt, um Druck zumachen, dass funktionierende Hardware ersetzt wird!«[55] Kurz: weniger Freiheit,aber mehr Müll. Mit »Geld-light«-Commoning haben Hacker-Communities in denfrühen 2000er-Jahren dazu beigetragen, Microsofts Missbrauch von Windows undOffice entgegenzuwirken. Aber nicht, indem sie die Konzerne angriffen, sondernindem sie GNU/Linux, Open Office und Dutzende andere Open-Source-Programme von hoher Qualität als praktische, kostengünstige oder kostenlose Alternativenzu den Standardprogrammen der Marktgiganten entwickelten. Durch die Peer-Produktion von Software, die weitergegeben werden darf, können Menschen neueCommons in digitalen Umgebungen schaffen und außerdem drakonische Lizenzvereinbarungen und den Missbrauch der Marktmacht meiden. Nutzerinnen undNutzer können nicht nur sicher sein, dass ihre Programme mit anderen Systemenkompatibel sind und dass dessen Veränderung und Weiterentwicklung erlaubt ist;sie können auch nicht unter Druck gesetzt werden, teure, unnötige Upgrades zubezahlen.
In analogen Umgebungen gibt es viele bewährte Möglichkeiten, die eigenenKosten gering zu halten und weniger geldabhängig zu sein. Wohnen ist ein gutesBeispiel. Sogenannte Community Land Trusts in Kanada oder den USA könnendie laufenden Kosten für Wohnraum und kleine Unternehmen erheblich reduzieren, indem sie das Land, auf dem Wohn- und Wirtschaftsgebäude stehen, aus demMarkt nehmen. Auch Peer-to-Peer-Carsharing und -Projekte, in denen Werkzeuge gemeinsam genutzt werden – wie die Offenen Werkstätten – sind Formen desGeld-light-Commoning.
Geld-light-Commoning beginnt auf individueller Ebene mit einer einfachenFrage: Was brauche ich wirklich? Diese Frage zu beantworten lenkt die Aufmerksamkeit auf die tatsächlichen Bedürfnisse und hilft der schleichenden Entmachtung zu entgehen, der mit einer konsumzentrierten Kultur einhergeht. Die kapitalistische Wachstumswirtschaft verschlingt außerordentlich viel Energie und Geldmit ihren – bemerkenswert kreativen – Versuchen, Menschen zum Konsumierenzu bewegen, obgleich so vieles davon unnötig ist. Aus neuen Konsummustern resultieren – notwendigerweise – neue Infrastrukturen. Es sind Infrastrukturen derAbhängigkeit. Diese wiederum ermöglichen ganz neue Produkte, die kurz daraufals lebensnotwendig gelten. Das war beim Auto so und ist beim Smartphone nichtanders. Commoners können vielen dieser vermeintlichen Notwendigkeiten entkommen, indem sie ihre eigenen Systeme, Infrastrukturen, Räume und Ressourcenpools zur gemeinsamen Nutzung entwickeln.
Gemeinsame Finanzierung bedeutet, Geld von Einzelpersonen, der Gemeinschaft und der breiteren Öffentlichkeit zusammenzulegen (zu poolen), um gemeinsame Prozesse und Vermögenswerte zu finanzieren. Das stärkt Commons nicht nur hier und heute, sondern schafft auch Grundlagen für das Commoning der Zukunft, etwa durch den Auf bau geeigneter Infrastrukturen oder die Entwicklung neuer Projekte. Gemeinsame Finanzierungsmodelle gibt es schon sehr lange u.a. die Kreditgesellschaften auf Gegenseitigkeit, Versicherungspools, gemeinschaftlich kontrollierte Mikrofinanzierungen und Lokalwährungen. In jüngerer Zeit konnten durch webbasiertes Crowdfunding völlig neue Dimensionen erschlossen und unzählige kleine, aber auch sehr große Projekte finanziert werden. Goteo, eine Crowdfunding-Plattform für Commons mit Sitz in Madrid[56], ist eine Pionier in diesem Feld. Seit der Gründung 2012 bis Ende 2018 wurden über Goteo mehr als 7,3 Millionen Euro mobilisiert, mehr als 900 Commons-Projekte in ganz Europa und Lateinamerika finanziert und circa 2.500 weitere Projekte online unterstützt.[57] Goteo unterscheidet sich von konventionellen Crowdfunding-Websites durch die Vorgabe, dass Projekte tatsächlich Commons-Prinzipien umsetzen müssen.
Das Crowdfunding von Freiem Wissen: Die Finanzierung durch die Nutzerinnen und Nutzer selbst sichert auch den Wikimedia-Projekten Unabhängigkeit. In der alljährlichen Spendenkampagne zum Jahresende 2017 nahm Wikimedia 8,7 Millionen Euro ein. Die durchschnittliche Spendenhöhe lag bei circa 13 Euro. Die Verwendung dieser Mittel wird allerdings immer wieder kritisiert. Ein Stein des Anstoßes ist, dass ein Großteil der Gelder in die us-amerikanische Wikimedia-Zentrale fließt, wo die Gehälter der Festangestellten entsprechend hoch sind. Andererseits kommt auch bei Wikimedia ein interessantes Muster zum Tragen, das wir in Kapitel 6 näher vorstellen werden: Poolen & Aufteilen. Die Spendeneinnahmen werden zunächst gesammelt und anschließend auf 16 Wiki-Projekte verteilt. Sie sichern freien Zugang zum Online-Wörterbuch, zu einer Zitatdatenbank, zu Sammlungen digitaler Bücher und Lernmaterialien, zu Datenbanken von Pflanzen- und Tierarten, Reiseführern sowie Archiven mit Fotografien und Bildern für alle. Darüber hinaus fließt das Geld in Projekte, die im Netz nicht sichtbar sind. So werden Strukturen aufgebaut, um Menschen in Afrika Zugang zu freiem Wissen zu sichern, oder Wikimedia engagiert sich in politischen Initiativen rund um Netzneutralität und Urheberrecht. Darüber hinaus nützt uns allen eine Wissensplattform »jenseits des Marktes«, weil sie uns zugleich von den Werbebotschaften und der Datensammelpraxis kommerzieller Anbieter befreit.
Von der digitalen in die analoge Welt: Die französische Organisation Terre de Liens sammelt Geld, um für angehende Kleinbäuerinnen und Kleinbauern Land zu kaufen und dieses Land auf Dauer dem Markt zu entziehen. Ein Teil der Finanzierung, die für einen bestimmten Hof zusammengetragen wird, fließt in die sogenannten »Solidaritätsersparnisse«. Diese werden ausschließlich für den Kauf weiteren Agrarlandes – also für die Finanzierung weiterer Projekte – genutzt. In Deutschland macht das Mietshäuser Syndikat (siehe Kapitel 8) etwas Ähnliches. Es unterstützt Hausprojekte in der eigenständigen Finanzierung gemeinschaftlicher Wohnprojekte, sorgt ebenso dafür, dass die Immobilien dem Markt entzogen werden und stellt zudem sicher, dass es eine solidarische Finanzierung im Verbund gibt. Das Mietshäuser Syndikat nimmt 10 Cent pro Quadratmeter Wohnraum pro Monat von allen Bewohnerinnen und Bewohnern der mit dem Syndikat assoziierten Gemeinschaftswohnprojekte ein. Dieses Geld wird eingesetzt, wenn neue Wohn-Commons auf Solidartransfers angewiesen sind.
Vom Dach über dem Kopf zur Gesundheitsversorgung: Artabana ist ein Verbund, in dem Tausende Menschen aus der Schweiz, Deutschland und Australien ihre Gesundheitsfürsorge gemeinschaftsbasiert finanzieren. Auch hier ist die Strategie ähnlich. Artabana ist – ähnlich den unabhängigen Hausprojekten im Mietshäuser Syndikat – in überschaubaren Gruppen organisiert. Die Mitglieder eine Gruppe übernehmen füreinander die Rolle des Sozialversicherers. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Wahl der Ärztin bzw. des Arztes, der Behandlungsoption, der Medikamente oder Heilmittel. Die Gruppen bestimmen eigenständig und im Vertrauensraum, wie sie ihre gegenseitige Unterstützung organisieren. Sie bestimmen auch, wie sie die Mittel aus dem Solidaritätsfonds verwenden, zu dem jede Gruppe als Gruppe beiträgt. Außerdem wird ein Teil des lokal zusammengetragenen Geldes in einen sogenannten Nothilfefonds eingezahlt, der von Artabana International verwaltet wird. Meistens kann eine Gruppe für die Gesundheitsfürsorge ihrer Mitglieder durch das Poolen & Aufteilen von Geld aufkommen. Ist jedoch eine lokale Gruppe mit unerwartet hohen Behandlungskosten konfrontiert – etwa im Fall chronischer Krankheiten oder komplizierter Operationen – kann dieser Nothilfefonds des Verbundes die Lösung sein. Er funktioniert wie eine Art Rückversicherung innerhalb des gemeinschaftsbasierten Versicherungssystems. Als Jane[58] in Australien wegen eines schweren Herzleidens operiert werden musste, planten sie und ihr Mann, die vorgesehenen Kosten von AUS-$ 35.000 durch eine Hypothek auf ihr Haus zu finanzieren. Es stellte sich jedoch heraus, dass ihre lokale Artabana-Gruppe bereits Artabana Deutschland kontaktiert hatte, und der dortige Nothilfefonds war in der Lage, die Operationskosten zu decken. »Dass der Nothilfefonds von Artabana Deutschland mich unterstützen würde, ohne mich zu kennen, überraschte uns und erfüllte uns mit tiefer Dankbarkeit und Demut. ... Innerhalb einer Woche war das Geld auf unserem Konto bei Artabana Hobart. Am Anfang war es schwierig, diese Geste von Fremden anzunehmen.« Aber in einer Artabana-Kultur, einer Kultur des Commoning, ist das letztlich nicht ungewöhnlich. Artabana kann auch größere Risiken abdecken, denn es funktioniert wie ein Verbund von gemeinschaftsgetragenen und selbstbestimmten Finanzierungspools.
Vom Geld selbst: Es gibt zudem eine weltweite Bewegung, die eigenes Geld ausgibt und kontrolliert, um die Probleme anzugehen, die mit externer Finanzierung verbunden sind. Weltweit existieren Tausende lokaler Währungen oder Peer-to-Peer-Kreditsysteme, die das konventionelle Geld meist ergänzen und in begrenzten Regionen spezifische Probleme lösen sollen, wobei sie mehr oder weniger erfolgreich sind. Ihre Zahl genau anzugeben ist schwierig. Der Forscher Grzegorz Sobiecki schätzt sie auf über 6.000.[59] In sehr armen Vierteln einer kenianischen Großstadt zirkulieren zum Beispiel der Bangla Pesa und der Lida Pesa. Beide Währungen gehören zum größeren Sarafu-Kreditsystem, das den Mitgliedern ermöglicht, die Leistungen und Vermögenswerte zu erfassen, die im Viertel erbracht werden, sie in Umlauf zu bringen und dabei zu verhindern, dass sie nach außen abfließen. In diesem Sinne fungieren sie als Bausteine einer commons-basierten Ökonomie.
Alle hier vorgestellten Plattformen und Verbünde – Goteo, Terre de Liens, Mietshäuser Syndikat, Artabana oder Lokalwährungen – erbringen irgendeine Art »kollektiven Zugewinns«. So müssen Werke, die über Goteo finanziert werden, unter einer freien oder einer Creative-Commons-Lizenz publiziert werden. Auf diese Weise kann das, was gemeinschaftlich finanziert wurde, künftig kopiert, weitergegeben und/oder modifiziert werden. Das Grundprinzip lautet: Wer von einem Commons etwas entnimmt, muss auch etwas zurückgeben. Zudem geht es in allen Beispielen nicht nur darum, Projekte gemeinschaftlich zu finanzieren, sondern auch darum, bestimmte Vorteile »in die Zukunft weiterzugeben« (engl. pay-it-forward mechanism).
Neue Finanzkreisläufe zwischen Commons und der öffentlichen Hand schaffen. Manche Marktakteure werden vom Staat großzügig mit Subventionen, rechtlichen Privilegien oder durch die Anerkennung von Quasi-Monopolen unterstützt. Warum sollte für Commoning nicht das Gleiche gelten? Staatliche Investitionen könnten Räume öffnen und Infrastrukturen schaffen, Commons mitfinanzieren und kreative neue Finanzierungsinstrumente entwickeln. Vieles ist denkbar. Naheliegend ist zunächst, dass der Staat Commons-Projekte ebenso großzügig und direkt finanziell unterstützt wie er Steuergelder für alle möglichen Zwecke einsetzt, die als gesellschaftlich relevant gelten. Problematisch ist, dass staatliche Finanzierung oft mit restriktiven und wenig lebensnahen, bürokratischen Verfahren einhergeht. Zudem werden oft in einem bestimmten Zeitraum messbare Ergebnisse erwartet, die zu liefern sind. Für Experimente, Ausprobieren und schöpferische Prozessgestaltung bleibt da oft zu wenig Raum. Daher wäre es zu begrüßen, wenn staatliche Förderung für Commons auf die Entwicklung neuer Ideen setzt – und zwar ähnlich bedingungslos wie die us-amerikanische Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) unbefristete Anschubfinanzierungen für die Entwicklung innovativer Technologien bereitstellt. Wenn Commoners sich heute um Finanzierungen seitens des Staats bemühen, ist Vorsicht geboten – nicht nur wegen des Verfahrensaufwands, der oft Energien verschlingt, die anderswo dringend gebraucht werden, sondern auch wegen der Bedingungen, die an solche Unterstützung geknüpft sein können. Externe Finanzierung kann die Integrität eines Projektes verzerren, zum Beispiel indem es politischen Interessen Tür und Tor öffnet. Darüber hinaus existiert das Risiko, dass die Unterstützung abrupt beendet wird, sobald sich die politischen Winde drehen. Einigen dieser Probleme könnte der Wind aus den Segeln genommen werden, etwa durch Grundfinanzierungen, die einfach zum staatlichen Haushalt gehören. Auch die Erhebung von Pauschalgebühren ist denkbar – ähnlich wie das heute schon für Musikaufnahmen und andere kreative Inhalte gilt. Sie könnte von der Kreativbranche erhoben werden – als obligatorischer, aber symbolischer Beitrag zur nicht-kommerziellen Kultur, von der sie letztlich abhängig ist, um neue Talente zu identifizieren und zu »verwerten«. Ein solcher Finanzierungsmechanismus wäre überschaubar und ließe sich gut planen und leicht hochskalieren. Und er könnte zahlreichen kreativen Menschen helfen.[60]
Genauso wie staatliche Behörden häufig Unternehmen unterstützen, indem sie Bürgschaften oder Kredite bereitstellen, könnten Förderprogramme aufgelegt werden, um Land freizukaufen, von Commoners bewirtschafteten Wohnraum zu sichern oder die Infrastruktur von FabLabs, Telecommons[61] und kosmo-lokaler Produktion zu finanzieren. Auch könnte ein bestimmter Prozentsatz der Steuereinnahmen aus der Fischerei oder der Forstwirtschaft in einen Finanzierungspool eingezahlt werden. Dieser würde von commons-affinen Organisationen verwaltet, die treuhänderisch arbeiten, um Küstenbereiche, Wälder oder Naturreservate zu bewirtschaften.
Das vielleicht ambitionierteste Programm wäre ein gemeinschaftsgetragenes bedingungsloses Grundeinkommen. Derzeit werden weltweit zahlreiche Modelle diskutiert. Der Gedanke, die konkrete Ausgestaltung eines solchen Grundeinkommens lokal zu verankern – ähnlich wie das im weltweit ersten Grundeinkommensprojekt (2008/2009) in den namibischen Dörfern Otjivero und Omitara geschehen ist –, wird in dieser Diskussion häufig übersehen. Doch was, wenn nicht einfach den Einzelnen, sondern den Einzelnen in und mit ihren Communities die Entscheidung überlassen würde, wie die meist sehr geringen Mittel verwendet und ihre Zeit und Talente genutzt werden können?
Anmerkungen
- Robert C. Ellickson: Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994. ↩
- Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende: jenseits von Staat und Markt, a.a.O., 1999, S. 117. ↩
- Christopher Alexander: The Nature of Order, Band II, a.a.O., S. 176. ↩
- Ebd. S. 177. ↩
- Das mag sich mit der rasanten Zunahme von Datenverarbeitungskapazitäten ändern. ↩
- Guy Abeille, ehemaliger Mitarbeiter im französischen Finanzministerium. ↩
- Christian Schubert, 26.09.2013, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/3-prozent-defizitgrenze-wie-das-maastricht-kriterium-im-louvre-entstand-12591473.html. ↩
- Wenig belastbare ökonomische Begründungen wurden nachträglich konstruiert. ↩
- Luxemburg, Estland und das Nicht-Euro-Land Schweden, vgl. https://www.nzz.ch/wirtschaft/europaeische-waehrungsunion-fuenf-antworten-zum-maastricht-vertrag-ld.133407 ↩
- Simone Cicero, Entwickler digitaler Plattformen, glaubt, dass Online-Plattformen nur dann gelingen können, wenn sie Menschen »erweiterte Möglichkeiten [bieten], ihr verfügbares Potenzial (die ihnen zugänglichen Ressourcen und Fähigkeiten) einzusetzen; auf den vielfältigen Druck zu reagieren, den sie (in einer techno-sozial gestörten Welt) erfahren; ihre strategischen Ziele zu erreichen; und wenn sie ihnen relevante Vorzüge bieten (leichtere, billigere, schnellere Möglichkeiten zum Ziel zu kommen).« Simone Cicero: »Stories of Platform Design«, https://stories.platformdesigntoolkit.com. ↩
- Der offizielle Name von Unitierra [Universität der Erde] ist Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, A.C.↩
- Interview mit Gustavo Esteva, 4. Dezember 2017.↩
- Henry David Thoreau: Walden: oder Leben in den Wäldern, Zürich: Diogenes, 1979, S.457.↩
- Jukka Peltokoski, Niklas Toivakainen, Tero Toivanen und Ruby van der Wekken: »DieZeitbank von Helsinki: Währung als Commons«, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, Bielefeld:transcript Verlag, 2015, S. 187-190, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons.↩
- Eric Nanchen und Muriel Borgeat: »Bisse de Savièse: Eine Zeitreise zu den Bewässerungskanälen des Wallis«, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.),ebd., S. 61-64.↩
- Gloria Chang: In einem Atemzug – Auf Tauchgang mit den Frauen der Insel Cheju vorSüdkorea. Memento vom 12. Februar 2013 im Webarchiv archive.is, in: Readers Digest Exklusiv, Leseecke.↩
- Im Dezember 2016 wurde die Kultur der Seefrauen von der UNESCO auf die Liste desimmateriellen Weltkulturerbes gesetzt, https://ich.unesco.org/en/RL/culture-of-jeju-haenyeo-women-divers-01068.↩
- Arthur Brock: »Cryptocurrencies are Dead«, Medium, 15. September 2016, https://medium.com/metacurrency-project/cryptocurrencies-are-dead-d4223154d783. Siehe auch Mike Hearn: »Why is Bitcoin Forking?« Medium, 15. August 2015, https://medium.com/faith-and-future/why-is-bitcoin-forking-d647312d22c1.↩
- Stefan Brunnhuber: Die Kunst der Transformation, Wie wir lernen, die Welt zu verändern, Freiburg: Herder Verlag, 2016, S. 56.↩
- Ebd.↩
- Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende, a.a.O., S. 122. ↩
- Christopher M. Kelty: Two Bits: The Cultural Significance of Free Software, Durham, NC: Duke University Press, 2008, S. 118. ↩
- Analog von der Linux-Philosophie, etc. ↩
- C.M. Kelty, a.a.O., S. 142. ↩
- Lewis Thomas: Das Leben überlebt, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1976, S. 193. ↩
- Kate Chapman: Commoning in Katastrophenzeiten. Das »Open Street Map«-Team für humanitäre Einsätze, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, a.a.O., S. 200-203, http://www.tran script-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons. ↩
- Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende, a.a.O., S. 121. ↩
- Das gilt online für Open-Access-Plattformen wie https://www.ssoar.info/ssoar/ für geisteswissenschaftliche Literatur, einem Projekt des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften genau wie für das inzwischen gigantische, gemeinnützige Internet-Archiv, archive. org, welches bereits 1996 von Brewster Kahle gegründet wurde. Heute ist es nicht nur Archiv für digitalisierte Texte, sondern sammelt auch Audiodateien, Videos, Bilder und Software. Das Ziel ist die Langzeitarchivierung und die Sicherung des (barriere-)freien Zugangs. Es gilt aber auch für sogenannte Schattenbibliotheken wie Sci-Hub und Library Genesis (LibGen), die einige Millionen wissenschaftlicher Artikel aus allen Fachgebieten bereithalten oder auf Anfrage bereitstellen: https://sci-hub.se/ und http://gen.lib.rus.ec/. Letzte sind als Reaktion auf eine Situation entstanden, die der Ideengeschichtler und Direktor der Universitätsbibliothek der Harvard Universität so beschreibt: »Wir alle haben es mit einem Paradox zu tun. Wir, an den Fakultäten, forschen, verfassen die Artikel, begutachten die Texte anderer, sitzen in Herausgebergremien – alles gratis ... und dann kaufen wir die Ergebnisse unserer Arbeit zu unerhörten Preisen [von den Wissenschaftsverlagen – S.H.] zurück«, https://www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices. ↩
- J. Stephen Lansing: Perfect order: Recognizing Complexity in Bali, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. ↩
- Ebd. ↩
- Richard Bartlett und Marco Deseriis: »Loomio and the Problem of Deliberation«, Open Democracy, 2. Dezember 2016, https://www.opendemocracy.net/en/digitaliberties/loomio-and-problem-of-deliberation/. ↩
- Ted J. Rau und Jerry Koch-Gonzalez: Many Voices, One Song: Shared Power with Sociocracy, Amherst: Sociocracy for All, 2018. Vgl.: www.sociocracyforall.org. ↩
- Vgl. diese Begründung für einen commons-affinen Umgang mit Soziokratie www.sociocracyforall.org/sociocracy/#whySoFA. ↩
- Für weitere Informationen siehe http://www.sk-prinzip.eu. ↩
- »Wir sind ein großes Gespräch« in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, a.a.O., S. 255-261, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons. ↩
- Zum Zeitpunkt, als dieses Interview geführt wurde, 2014. ↩
- Ebd. ↩
- Nicolas Kristof: »The Bankers and the Revolutionaries«, The New York Times, 1. Oktober 2011, https://www.nytimes.com/2011/10/02/opinion/sunday/kristof-the-bankers-and-the-revolutionaries.html. ↩
- Weitere Ideen dazu in Teil III dieses Buches. ↩
- Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende, a.a.O., S. 123. ↩
- F. Cleaver: »Moral Ecological Rationality, Institutions and the Management of Common Property Resources«, Development and Change, 31(2): 374 (2000), in: Michael Cox, Gwen Arnold und Sergio Villamayor Tomás, »A Review of Design Principles of Community-Based Natural Resource Management«, Ecology & Society 14(4): 38, http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art38. ↩
- R.Y. Siy Jr. (1982): Community Research Management: Lessons from the Zanjeras, Quezon City: University of the Philippines Press, S. 101, zitiert in: Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende, a.a.O., S. 113. ↩
- Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 630 (1886). Das Zitat im Original: »intimate activity associated with the sanctity of a man’s home and the privacies of life.« ↩
- Nach der Encyclopedia Britannica, hielt die Bewegung im Jahr 2014 mehr als 2.500 ungenutzte Ländereien besetzt. Mehr als 370.000 Familien waren an den Besetzungen beteiligt, und Landtitel für fast 7,5 Millionen Hektar konnten erstritten werden. ↩
- Die Katholische Soziallehre wurde insbesondere seit der Enzyklika von Papst Leo XIII, Rerum novarum, im Jahr 1891 schrittweise als sozialethische Lehre entwickelt. Siehe auch: Charles C. Geisler und Gail Daneker (Hrsg): Property and values: alternatives to public and private ownership, Washington DC: Island Press, 2000, S. 31. ↩
- International Co-operative Alliance: »World Co-operative Monitor«, https://monitor.coop. ↩
- Mako Hill: »Problems and Strategies in Financing Voluntary Free Software Projects«, 10. Juni 2005, https://mako.cc/writing/funding_volunteers/funding_volunteers.html. ↩
- Hill verweist auf Forschungsarbeiten von Bernard Enjolras am Institute for Social Research in Oslo, Norwegen. Enjolras hat die Rolle und den Charakter der Freiwilligenarbeit in norwegischen Sportorganisationen erforscht, nachdem die monetäre Vergütung bestimmter buchhalterischer und organisatorischer Tätigkeiten eingeführt wurde. Das Ergebnis war, dass weniger Menschen freiwillig mitarbeiteten, und diejenigen, die es taten, arbeiteten weniger. Bernard Enjolras: »Does the Commercialization Of Voluntary Organizations ›Crowd Out‹ Voluntary Work?«, Annals of Public and Cooperative Economics 73:3 (2002), S. 375-398. ↩
- Vgl.: https://discourse.transformap.co/t/separate-commons-and-commerce-to-make-it-work-for-the-commons/625. ↩
- Encommuns: »Separate Commons and Commerce to Make it Work for the Commons,« http://encommuns.org/#/economique. ↩
- https://wiki.guerrillamediacollective.org/index.php/Commons-Oriented_Open_Cooperative_Governance_Model_V_2.0. ↩
- Mehr Informationen auf: https://nextcloud.com/. ↩
- Nachzuhören unter: https://media.ccc.de/v/bub2018-240-digitalisierung_und_degrowth_wege_zu_einem_enkeltauglichen_wirtschaften#t=1117. ↩
- Vgl.: https://karlitschek.de/2016/04/big-changes-i-am-leaving-owncloud-inc-today/ ↩
- Lorenz Hilty: Keynote, Bits & Bäume, 17. November 2018, Berlin. ↩
- Die Website gibt es auch in deutscher Sprache: https://de.goteo.org/. Letzter Zugriff am 21.11.2018. Die folgenden Angaben entsprechen diesem Zeitpunkt. ↩
- Mehr zu Goteo: Enric Senabre Hidalgo: »Mit vereinten Kräften. Wie man Commons per Crowdfunding finanziert«, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, a.a.O., S. 223-227, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons. ↩
- Name geändert. ↩
- Vgl.: https://www.quora.com/How-many-complementary-currency-systems-exist-worldwide. Es existieren unterschiedliche Sammlungen und »Kredit«-Karten. Eine der wichtigsten wird vom Complementary Currency Resource Center kuratiert: http://complem entarycurrency.org/cc-world-map. ↩
- Philippe Aigrain: http://paigrain.debatpublic.net/docs/internet_creation_1-3.pdf. ↩
- https://www.telecommons.org/.↩
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Teil 1 – Commons grundlegen
- Teil 2 – Commons verstehen und leben
- Einleitung: Die Triade des Commoning
- Kapitel 4: Soziales Miteinander
- Kapitel 5: Selbstorganisation durch Gleichrangige
- Kapitel 6: Sorgendes & selbstbestimmtes Wirtschaften
- Teil 3 – Das Commonsversum
- Einleitung: Wie das Commonsversum wachsen könnte
- Kapitel 7: Eigentümlich denken
- Kapitel 8: Haben & Sein
- Kapitel 9: Commons im Staat
- Kapitel 10: Commons erMächtigen
- Anhang
- Danksagung